Die Informationsplattform der Schweiz für Pflege und Betreuung

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Foto von Max Boehme auf Unsplash
Demenzpflege in Dänemark
Kleine Wohngruppen statt sterile Heime, Alltag statt Institution, Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung – Vorbild für die Schweiz?
Dänemark gilt seit Jahren als eines der innovativsten Länder Europas, wenn es um die Pflege von Menschen mit Demenz geht. Statt Isolation und Stationspflege dominieren dort Wertschätzung, Selbstbestimmung und Alltag auf Augenhöhe.
Doch wie genau sieht diese dänische Praxis aus – und was können wir in der Schweiz daraus lernen?
Pflege in kleinen, familiären Einheiten
Statt große, anonyme Heime setzt Dänemark auf kleinteilige Wohnformen. Menschen mit Demenz leben in kleinen Wohngruppen, oft mit nur 6–8 Personen, in einer Umgebung, die dem Zuhause ähnelt – mit Küche, Garten, Wohnzimmer.
Diese Wohnformen haben klare Vorteile:
- Reduktion von Stress und Orientierungslosigkeit
- Förderung von Tagesstruktur und Selbstwirksamkeit
- Intensivere Betreuung durch feste Bezugspersonen
Das Personal ist dabei interdisziplinär geschult: Pflegekräfte kochen gemeinsam mit den Bewohner:innen, machen Spaziergänge, organisieren kreative Aktivitäten. Technik wird dezent im Hintergrund eingesetzt – z. B. für Bewegungsüberwachung oder automatische Lichtsteuerung.
Stadtplanung mit Demenz im Blick
Ein weiterer faszinierender Aspekt ist die demenzfreundliche Architektur, nicht nur in Pflegeeinrichtungen, sondern auch im öffentlichen Raum:
- Klar beschilderte Gehwege
- Farbcodierte Türen und Räume
- Kreisförmige Gartenwege (Verirrung ohne Sackgassen)
- Gemeinschaftsräume mit bewusst gesetzten Alltagsreizen
Diese Maßnahmen fördern die Orientierung und das Sicherheitsgefühl – auch für Menschen mit beginnender Demenz, die noch zuhause wohnen.
Angehörige als Partner, nicht als Belastung
In Dänemark werden pflegende Angehörige nicht allein gelassen, sondern als Teil des Pflegesystems gesehen. Sie werden systematisch in Entscheidungen eingebunden, erhalten Schulungen, psychologische Unterstützung – und vor allem: Entlastung durch gute öffentliche Angebote.
Zentrale Elemente:
Flexible Tagesstätten für Menschen mit Demenz
Ferienbetreuung (vergleichbar mit „Kurzzeitpflege light“)
Finanzielle Unterstützung und Beratung
Was kann die Schweiz übernehmen?
Auch in der Schweiz existieren erste demenzfreundliche Projekte. Doch viele Pflegeheime sind weiterhin stark institutionell geprägt.
Lernpunkte aus Dänemark:
- Kleinräumige Wohngruppen statt Grossheime
- Demenzfreundliche Architektur auch im Quartier
- Frühzeitige Einbindung von Angehörigen
- Fokus auf Alltagskompetenz statt nur Versorgung
- Flächendeckende Schulung des Pflegepersonals
Würdevolle Demenzpflege ist machbar – auch hier
Dänemark zeigt, dass Demenzpflege nicht zwangsläufig mit Verlust, Rückzug und Krankenhausatmosphäre verbunden sein muss. Im Gegenteil: Mit dem richtigen System können Menschen mit Demenz weiterhin am Leben teilhaben – sicher, begleitet und respektiert. Für die Schweiz lohnt sich der Blick nach Norden – nicht zum Kopieren, sondern als Inspiration für lokal angepasste Lösungen.

Quelle: Studie (→ Link)
Bildnachweis: Foto von Mathias Reding auf Unsplash
Musiktherapie bei Demenz
Wie lässt sich Musik im Pflegealltag nutzen?
Was kann Menschen mit Demenz helfen, wenn Medikamente an ihre Grenzen stossen? Eine aktuelle Network-Meta-Analyse aus dem Jahr 2024, veröffentlicht im European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, bringt eine klare Antwort: Musiktherapie – besonders in aktiver Form mit Gesang – zeigt signifikant positive Effekte auf kognitive Fähigkeiten und Stimmung.
Studie mit über 1’000 Teilnehmenden: Klare Vorteile für AMT + Sing
Die Forscher:innen analysierten 25 kontrollierte Studien mit insgesamt 1’056 Demenzpatient:innen, die verschiedene Formen der Musiktherapie erhielten. Besonders überzeugend schnitt ab: AMT + Sing – also aktive Musiktherapie, bei der Patient:innen selbst singen, musizieren oder rhythmisch teilnehmen.
Im Vergleich zu anderen Interventionen und zur Standardpflege zeigte diese Form:
- Deutlich verbesserte kognitive Leistungen, z. B. bei Aufmerksamkeit und Gedächtnis
- Reduktion depressiver Symptome
- Keine erhöhte Abbruchrate – im Gegenteil: Die Teilnehmenden blieben engagiert und motiviert
Auch rhythmische Musiktherapie (RMT) und aktive Musiktherapie ohne Gesang (AMT) zeigten positive Effekte, aber AMT + Sing war am konsistentesten wirksam.
Warum wirkt Musiktherapie mit Gesang besonders stark?
Die Studienautor:innen vermuten mehrere Gründe:
- Singen aktiviert viele Hirnareale gleichzeitig, u. a. für Sprache, Emotion, Bewegung und Gedächtnis
- Aktive Beteiligung stärkt Selbstwirksamkeit und soziale Verbindung
- Rhythmus und Melodie schaffen emotionale Sicherheit und Zugang zu biografischen Erinnerungen
Besonders erstaunlich: Auch Menschen mit fortgeschrittener Demenz konnten durch musikalische Aktivitäten wieder in Kontakt mit sich und ihrer Umgebung treten – oft nonverbal, aber tief berührend.
Praktische Umsetzung in der Pflege
Musiktherapie muss nicht aufwendig sein – schon kleine Schritte bringen Wirkung:
- Gemeinsames Singen bekannter Volks- oder Lieblingslieder
- Rhythmusinstrumente wie Rasseln, Trommeln oder Klatschen
- Biografische Musik-Playlists auf Handy oder Musikbox
- Gruppensitzungen mit ausgebildeter Musiktherapeutin (z. B. 1x pro Woche)
Pflegefachpersonen können die Erkenntnisse direkt im Alltag umsetzen – mit Unterstützung durch Musikpädagog:innen, Angehörige oder ehrenamtliche Musiker:innen.
Musik ist mehr als Begleitprogramm – sie ist Therapie
Die Meta-Analyse belegt: Aktive Musiktherapie mit Gesang ist eine wirkungsvolle, sichere und kostengünstige Intervention bei Demenz. Sie fördert Lebensqualität, kognitive Fähigkeiten und seelisches Wohlbefinden – ganz ohne Nebenwirkungen.
In der Schweiz gibt es erste Pilotprojekte in Alterszentren – doch die Integration von Musiktherapie in den Pflegealltag verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Foto von Val Vesa auf Unsplash
Community-basierte Pflege
Die klassische stationäre Pflege stösst zunehmend an ihre Grenzen – sei es durch Personalmangel, steigende Kosten oder den Wunsch älterer Menschen, möglichst lange selbstbestimmt zu Hause zu leben. Immer mehr internationale Studien und Pilotprojekte setzen deshalb auf community-basierte Pflege. Doch was verbirgt sich genau dahinter – und könnte dieses Modell auch für die Schweiz eine Lösung sein?
Was ist Community-basierte Pflege?
Community-basierte Pflege (auch „gemeindenahe Pflege“ genannt) ist ein Konzept, das auf lokale Netzwerke, interprofessionelle Teams und frühzeitige Unterstützung setzt. Pflege wird dabei nicht nur als medizinische Versorgung verstanden, sondern als umfassende soziale Dienstleistung, die dort ansetzt, wo Menschen leben: im Quartier, im Dorf, in der Nachbarschaft.
Zentrale Merkmale:
Pflegekräfte arbeiten mobil und vernetzt mit Hausärzten, Sozialdiensten, Angehörigen und Freiwilligen.
Die Betreuung beginnt frühzeitig – oft schon, bevor Pflegebedürftigkeit im klassischen Sinn vorliegt.
Der Fokus liegt auf Erhalt der Selbstständigkeit, Prävention und Lebensqualität.
Internationale Beispiele zeigen Wirkung
Eine im Journal of Aging & Social Policy veröffentlichte Vergleichsstudie untersuchte community-basierte Pflegeprojekte in Kanada, den Niederlanden und Südkorea. Die Ergebnisse sind vielversprechend:
In den Niederlanden sorgte das bekannte Modell Buurtzorg für signifikante Verbesserungen in der Pflegequalität und Mitarbeiterzufriedenheit. In Südkorea werden speziell geschulte Pflegekoordinator:innen in lokalen Gesundheitszentren eingesetzt, um ältere Menschen frühzeitig zu betreuen. In ländlichen Regionen Kanadas helfen sogenannte Community Health Workers, die Brücke zwischen medizinischer Versorgung und Alltagsunterstützung zu schlagen.
Die Studienautoren betonen, dass diese Modelle weniger auf Hierarchie, dafür stärker auf Eigenverantwortung und Vertrauen setzen – sowohl auf Seiten der Pflegekräfte als auch der betreuten Menschen.
Chancen für die Schweiz
Auch in der Schweiz wird das Thema allmählich diskutiert. Einige Kantone (z. B. Luzern oder Zürich) testen Modelle der integrierten Versorgung, bei denen Spitex, Hausärzte und Sozialdienste eng kooperieren.
Vorteile einer community-basierten Pflege für die Schweiz könnten sein:
- Entlastung von Heimen und Spitälern
- Individuellere Betreuung in vertrauter Umgebung
- Bessere Einbindung von Angehörigen und Nachbarn
- Stärkung der lokalen Pflegeinfrastruktur
Doch es gibt auch Herausforderungen: Die Finanzierung solcher Modelle ist komplex, und es braucht klare Verantwortlichkeiten sowie gut ausgebildete, flexible Pflegefachpersonen.
Fazit: Pflege beginnt im Quartier
Community-basierte Pflege ist kein Allheilmittel – aber ein vielversprechender Ansatz, um der demografischen Entwicklung und den wachsenden Anforderungen im Pflegebereich zu begegnen. Sie setzt auf frühe, präventive und kooperative Pflege und bringt Pflege zurück ins Lebensumfeld der Menschen.
Für die Schweiz könnte das bedeuten: weniger zentralisierte Institutionen, dafür mehr lokale Pflegeprojekte, soziale Integration und personenzentrierte Versorgung.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Photo von Dominik Lange auf Unsplash
Wie finden Sie ein gutes Heim für Ihre Angehörigen – welche Kriterien spielen eine Rolle bei der Auswahl des Pflegeheims?
Der Entscheidungsprozess für die Heimsuche ist dann gelungen, wenn die Betroffenen mit der einmal getroffenen Entscheidung gut leben können. Dies kann durch eine gute, frühzeitige und umfassende Planung positiv beeinflusst werden.
- Pflegekosten
In einem Alters- und Pflegeheim fallen unterschiedliche Kosten an: Pensions-, Pflege-, Betreuungs- und übrige Kosten. Wer einmal in eine Institution eingetreten ist, kann durchaus mit sich verändernden Kosten konfrontiert sein: Wenn sich die Hotellerieleistungen (Zimmer, Verpflegung usw.) verändern, wenn sich der Pflegebedarf erhöht oder reduziert (Anpassung der Pflegestufe) oder sich die persönlichen Auslagen (Telefon, Coiffeur, nicht-kassenpflichtige Pflegeleistungen usw.) verändern. Massgebend für die Kosten ist die Taxordnung des Alters- und Pflegeheims, der ein Bestandteil des Pensionsvertrags ist.
Auch bei der Finanzierung können sich Änderungen ergeben, was unter Umständen zu einer Mehr- oder Minderbelastung bei den selbst getragenen Kosten führt. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn durch die Kantone Änderungen der Restfinanzierung, der Taxvorgaben oder der anrechenbaren Heimkosten (zur Bemessung der Ergänzungsleistungen) beschlossen werden. - Lage des Pflegeheims
Idealerweise ist das Heim im Umfeld des bisherigen Wohnorts gelegen, so dass den Senioren soziale Kontakte erhalten bleiben. Außerdem kann der Bewohner in vertrauter Umgebung bleiben. Wenn keine sozialen Kontakte mehr bestehen und Sie als Angehöriger weiter entfernt leben, kann es auch sinnvoll sein, ein Pflegeheim in Ihrer Nähe zu wählen - Pflegequalität
Grosse Bedeutung kommt bei der Pflegeheimsuche natürlich der Pflegequalität zu. Besonders wichtig sind die Punkte Pflege und medizinische Versorgung. Ist das Pflegeheim in der Lage auf die spezifischen Befindlichkeiten des zu Pflegenden bezüglich Physis und Psyche einzugehen? - Ausstattung und -Verpflegung
Gibt es Einzelzimmer mit eigenem Bad? Dürfen Bewohner ihre eigenen Möbel mitbringen? Sind TV-, Telefon- und Internetanschlüsse in den Zimmern vorhanden? Wie sehen die Gemeinschaftsräume aus? Wie sieht es mit einer Bibliothek, einem Bewohnertreff oder einer Cafeteria aus? Sind die Mahlzeiten frisch und abwechslungsreich, gibt es Wahlmenüs? Sind die Essenszeiten flexibel, die Speiseräume und das servierte Essen ansprechend? - Tagesstrukturierung und Beschäftigungsangebote
Können Bewohner ihren Tagesablauf individuell gestalten? Welche Beschäftigungs- oder Fitnessangebote gibt es? - Serviceleistungen
Können im betreffenden Altersheim Friseur, medizinische Fusspflege oder Einkaufsdienste organisiert werden? Die Liste lässt sich durch weitere Punkte ergänzen, z. B. (fach-)ärztliche Versorgung, Medikamentengabe oder seelsorgerische Angebote.
Idealerweise setzt der Informations- und Planungsprozess rund um das Wohnen und Leben im Alter so früh wie möglich ein – er kann entsprechend mehrere Jahre dauern. So hat man genug Zeit, sich mit den verschiedenen Wohnformen und den ambulanten und stationären Angeboten auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, welche Formen in welcher Situation für einen infrage kommen können. Ein weiterer Grund für die rechtzeitige Vorsorge ist die Tatsache, dass ein Heimeintritt mit Wartezeiten verbunden sein kann

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Bild von Freepik
Pflegeroboter
Chancen und Grenzen des Einsatzes
Wir werden immer älter und brauchen immer mehr Pflegekräfte. Man spricht bereits von einem Pflegenotstand. Können Pflegeroboter diese Lücke schliessen?
Wissenschaftler arbeiten an der Mechanisierung der Seniorenbetreuung durch Pflegeroboter. Solche Maschinen können Menschen nicht nur versorgen, sondern sogar ihre Gefühle deuten.
Arten von Pflegerobotern
Aktuell gibt es etwa ein Dutzend Pflegeroboter-Modelle auf dem Markt. Sie lassen sich grob in drei Grundkategorien unterteilen: Serviceroboter, Hebe-Roboter und soziale Roboter.
- Serviceroboter können alltägliche Aufgaben ausführen und Gegenstände transportieren. Zu ihnen zählen etwa die Modelle Casero 4, Terapio oder Care-o-bot.
- Neben Servicerobotern können auch Hebe-Roboter zur Entlastung des Pflegepersonals beitragen. Hierzu zählen die Modelle Robear und Evelon. Sie können körperlich schwere Arbeiten übernehmen und beispielsweise Patienten heben.
- Soziale Roboter sind für solche Arbeiten ungeeignet, decken dafür aber einen weiteren wichtigen Bereich des Pflegespektrums ab: Sie können die Regeln der interaktiven Kommunikation befolgen und sind in der Lage, Verhaltensmuster zu erlernen. Auch Stimmen erkennen sie. Zwei Beispiele dafür sind die Roboter Pepper und Paro.
Vorreiter bei Pflegerobotern ist Japan
Roboter helfen Pflegebedürftigen beim Waschen, Essen und Anziehen. Von Science Fiction keine Spur – denn in japanischen Altenheimen ist das schon jetzt Realität. Nirgendwo ist die teilautomatisierte Pflege so weit entwickelt wie im technikbegeisterten Japan. Hier geht der Pflegeauftrag eines Roboters sogar noch weit über physische Hilfestellungen hinaus. Der humanoide Roboter Pepper analysiert zum Beispiel Mimik und Gestik seines Gegenübers und ist so programmiert, dass er angemessen darauf reagiert. Sogar einfache Gespräche kann man mit ihm führen. Optisch weist er Merkmale eines Kindes auf. Das mag unwichtig erscheinen, doch das Gegenteil ist der Fall. Schließlich soll er auf Menschen so harmlos wie möglich wirken.
Pflegeroboter Pepper und Paro
Pflegeroboter sollen Ärzte und Pfleger entlasten. Bei schweren Hebearbeiten oder dem Speichern medizinischer Daten ist das auch kaum mehr ein Problem. Anspruchsvoller sind Aufgaben, bei denen der Roboter seine Anweisungen nicht vom Pflegepersonal bekommt, sondern auf Patienten reagieren soll. Roboter Pepper etwa kann Senioren im Altenheim zur Sitzgymnastik animieren, indem er die Rolle eines menschlichen Übungsleiters übernimmt. Klingt ambitioniert?
Noch ehrgeiziger sind Projekte, bei denen die Maschine auf emotionale Bedürfnisse eingeht. Roboter Paro, dessen Aussehen einem Robbenbaby ähnelt, wird therapeutisch genutzt. Er reagiert, wenn sich Personen in seiner Nähe bewegen und sich ihm nähern. Sobald man ihn streichelt, fiept und schnurrt er, bewegt den Kopf und schaut treuherzig. Mit anderen Worten: ein mechanischer Welpe. Und das Konzept funktioniert! Aus der tiergestützten Therapie entwickelt, lässt sich Paros beruhigende Wirkung auf Menschen unbestreitbar nachweisen. Er wird vor allem in der Betreuung von Menschen mit Demenz eingesetzt. Die Patienten sollen dadurch gesprächiger und gelöster werden.
Hersteller stehen noch vor vielen Herausforderungen
Gymnastik mit Pepper, Kuscheln mit Paro – so könnte der Alltag im Pflegeheim künftig aussehen. Noch ist vieles davon Zukunftsmusik. Denn noch scheitern die Maschinen oft an banalen Anforderungen: Einige Prototypen humanoider Roboter wurden nicht weiterentwickelt, weil sie sich auch nach mehreren Testläufen nicht flüssig genug bewegen konnten, um Pfleger und Patienten im Heim zu begleiten. In Europa kommen Pflegeroboter daher bislang nur im Rahmen von Forschungsprojekten zum Einsatz. Doch die Entwickler sind zuversichtlich, dass auch hierzulande in nicht allzu ferner Zukunft interaktionsfähige Maschinen zur Unterstützung menschlicher Pfleger genutzt werden können.
Ethische Betrachtung von Pflegerobotern: Hilfe oder Bedrohung?
Können Roboter eine wertvolle Unterstützung in der Pflege sein oder stellen sie eine Bedrohung dar? Diese Frage betrifft uns alle – ob im gesellschaftlichen Kontext, im privaten Umfeld oder auch persönlich.
Verschiedene Interessensgruppen – das Personal, die Einrichtungsleitungen und Patienten – stehen der Technologie unterschiedlich gegenüber. Es gibt bestimmte Bedenken, wenn es um Robotik in der Pflege geht.
Pflegepersonal
Pfleger befürchten, dass Roboter sie verdrängen werden und sie so ihren Job verlieren. Obwohl das Risiko wegen der begrenzten Fähigkeiten der Roboter aktuell noch gering ist, bleibt die potenzielle Bedrohung für das Personal real.
Ein weiteres Argument: Mit dem Geld, das in die Technologie fließt, könnte man auch eine bessere Bezahlung des bestehenden Personals gewährleisten – oder neue Pflegekräfte einstellen.
Pflegeeinrichtungen
Der Nutzen für Pflegeeinrichtungen hält sich aufgrund der eingeschränkten und sehr spezialisierten Fähigkeiten bereits existierender Roboter in Grenzen. Die Technik ist dafür schlichtweg zu teuer. Der Humanoide Pepper kostet knapp 1.700 Euro, die Roboter-Robbe Paro sogar 5.000 Euro. Und mit der reinen Anschaffung ist es nicht getan: Auch die Wartung und Reparatur der Pflegeroboter kosten Geld.
Aufgrund der akuten Personalengpässe in der Pflege stehen Einrichtungsleitungen der Technologie grundsätzlich aber offen gegenüber. Die Entlastung des Personals ist bereits jetzt ein wichtiger Faktor und wird in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Um sich allerdings als echte Hilfe im Pflegebereich zu etablieren, müsste ein Modell mehrere Fähigkeiten vereinen. Dazu ist die Technologie noch nicht in der Lage.
Pflegebedürftige
Patienten haben die wohl meisten Berührungspunkte mit Pflegerobotern. Zwar ist eine Verallgemeinerung hier unangebracht. Die Erfahrung zeigt aber, dass Patienten bei freier Wahl Pflegerobotern gegenüber nicht grundsätzlich abgeneigt sind. Vielmehr richtet sich die Ablehnung gegen einzelne Modelle und nicht gegen die Technologie an sich.
Kritik an Pflegerobotern
Pflegeroboter sind und bleiben Maschinen. Ein Hauptkritikpunkt besteht also in ihren Grundvoraussetzungen: der Technik. Auch wenn Entwickler immer größere Fortschritte machen und sich Pflegeroboter weiterentwickeln, mangelt es künstlichen Intelligenzen an der Feinmotorik und wichtigen menschlichen Eigenschaften wie Empathie. Ob Roboter jemals an diesen Punkt kommen und ob das überhaupt von der Gesellschaft erwünscht ist, bleibt fraglich.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die potenzielle Vereinsamung. Vor allem ältere und/oder kranke Menschen sind davon betroffen. Geräte, die auf die Interaktion mit Senioren ausgelegt sind, könnten den Kontakt zu „echten” Menschen noch weiter reduzieren. Vor allem Demenzkranke brauchen jedoch menschliche Nähe und Zuwendung.
Pflegeroboter: rechtliche Situation
Die rechtliche Lage rund um Pflegeroboter ist eine Grauzone. Die versicherungstechnischen Zusammenhänge sind weitgehend ungeklärt. Pflegeroboter werden nicht im Pflegehilfsmittel- und Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt. Nur wenige Modelle werden durch die Krankenkasse unterstützt. Die Finanzierung geeigneter Robotermodelle ist daher mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden.
Ein weiteres großes Hindernis ist der Datenschutz. Denn damit sich die Modelle – vor allem soziale Roboter – weiterentwickeln, müssen sie Daten sammeln. Unter Umständen dringen Pflegeroboter tief in die Intim- oder Privatsphäre von Patienten ein. Hier stellen sich die Fragen: Welche personenbezogenen Daten darf die Maschine sammeln? In welchen Fällen braucht es ein Einverständnis? Wie kann dieses Einverständnis gerade bei schwer kranken Patienten eingeholt werden? Noch gibt es darauf keine klaren Antworten.
Auch bezüglich der Haftung gibt es viele Unsicherheiten. Für Produktions- und Programmierfehler sind die Hersteller oder Entwickler verantwortlich. Wer haftet allerdings bei erlerntem Fehlverhalten? Und wessen Schuld ist es, wenn ein Roboter falsch bedient oder ein Patient durch die Maschine verletzt wurde?
Die Antworten darauf sind entscheidend für die Zukunft der gesamten Branche. Viele Entwickler halten sich wegen der Unsicherheiten und Hindernisse zurück. Denn die Risiken sind zum jetzigen Zeitpunkt kaum kalkulierbar.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Foto von Emiliano Vittoriosi auf Unplash
ChatGPT in der Seniorenpflege
Bedrohliche Zukunftsvision oder sinnvoller Fortschritt?
In einer Zeit, in der der demografische Wandel den Pflegebereich vor grosse Herausforderungen stellt, rücken innovative Technologien wie ChatGPT in den Fokus. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Seniorenpflege verspricht sowohl Entlastung für das Pflegepersonal als auch eine Verbesserung der Lebensqualität für die Bewohner. Doch wie gestaltet sich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine in der Praxis?
Chancen: Effizienzsteigerung und individuelle Betreuung
ChatGPT kann in der Pflege vielfältig eingesetzt werden:
- Unterstützung bei der Dokumentation: Die KI kann Pflegeberichte automatisiert erstellen und somit den administrativen Aufwand für das Personal reduzieren.
- Kommunikation mit Bewohnern: Durch Sprachverarbeitung kann ChatGPT Gespräche führen, Erinnerungen auslösen und somit zur mentalen Aktivierung beitragen.
- Assistenz bei der Medikamentenverwaltung: Die KI kann an Medikamenteneinnahmen erinnern und bei der Erstellung von Einnahmeplänen helfen.
Ein Beispiel für den praktischen Einsatz ist der soziale Roboter „Navel“, der mit ChatGPT-Technologie ausgestattet ist. In einem Pflegeheim in Hannover interagiert Navel autonom mit den Bewohnern, erkennt Situationen und reagiert entsprechend. Er nutzt dabei nicht nur gesprochene Sprache, sondern auch Mimik und Gestik, um eine natürliche Kommunikation zu ermöglichen.
Risiken: Datenschutz und ethische Bedenken
Trotz der Vorteile gibt es auch kritische Stimmen:
- Datenschutz: Die Verarbeitung sensibler Gesundheitsdaten durch KI-Systeme erfordert höchste Sicherheitsstandards, um Missbrauch zu verhindern.
- Entmenschlichung der Pflege: Es besteht die Sorge, dass der zwischenmenschliche Kontakt durch den Einsatz von KI reduziert wird, was insbesondere in der Seniorenpflege von großer Bedeutung ist.
- Abhängigkeit von Technologie: Eine übermässige Reliance auf KI könnte dazu führen, dass Pflegekräfte ihre eigenen Fähigkeiten weniger einsetzen und weiterentwickeln.
Ein übermässiger Einsatz von Technologie könnte dazu führen, dass der persönliche Kontakt zwischen Pflegekräften und Patienten vernachlässigt wird, was wiederum das Wohlbefinden der Pflegebedürftigen beeinträchtigen könnte.
Fazit: Ein ausgewogener Einsatz ist entscheidend
Der Einsatz von ChatGPT in der Seniorenpflege bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Während die Technologie das Potenzial hat, den Pflegealltag zu erleichtern und die Lebensqualität der Bewohner zu steigern, müssen Datenschutz, ethische Überlegungen und der Erhalt des menschlichen Kontakts stets im Blick behalten werden. Ein ausgewogener und verantwortungsbewusster Einsatz von KI kann dazu beitragen, die Pflege zukunftsfähig zu gestalten.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Foto von cottonbro studio auf pexels.com
Senioren und Frühling
Frühling für die Seele: Warum die Jahreszeit Senioren besonders guttut.
Der Frühling bringt nicht nur Licht und Farbe zurück ins Leben – er wirkt sich auch positiv auf das Wohlbefinden älterer Menschen aus. Doch was bedeutet das konkret für die Seniorenpflege?
Sonne, Wärme, Lebensfreude
Für viele Seniorinnen und Senioren ist der Frühling mehr als nur eine Jahreszeit – er ist ein Neuanfang. Nach den dunklen und oft bewegungsarmen Wintermonaten steigen mit den Temperaturen auch Stimmung, Energie und Aktivitätsniveau.
Vorteile des Frühlings für ältere Menschen
Mehr Tageslicht: Fördert die Vitamin-D-Produktion, stärkt die Knochen und verbessert die Stimmung.
Wärmere Temperaturen: Erleichtern Bewegung an der frischen Luft, lindern Gelenkbeschwerden.
Blühende Natur: Aktiviert die Sinne und sorgt für emotionale Stabilität.
Frühling als Chance für Aktivierung
In der Seniorenpflege bietet der Frühling zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung von Bewegung, sozialem Austausch und geistiger Aktivität. Pflegende und Betreuungspersonen können den natürlichen Aufschwung nutzen, um gezielte Aktivitäten zu planen.
Ideen für Frühjahrsaktionen in Pflegeeinrichtungen oder im häuslichen Umfeld
Gartenprojekte: Gemeinsames Pflanzen von Blumen oder Kräutern fördert die Feinmotorik und gibt das Gefühl, gebraucht zu werden.
Bewegungsangebote im Freien: Spaziergruppen oder Sitzgymnastik im Park regen Kreislauf und soziale Interaktion an.
Frühlingsfeste: Mit Musik, Kaffee und saisonale Speisen wie Spargel, Erdbeeren oder Bärlauch
Kreativangebote: Basteln mit Naturmaterialien, Malen von Frühlingsmotiven.
Frühling für die Seele – auch bei Demenz
Auch bei demenziell erkrankten Menschen kann der Frühling positive Reize setzen:
Bekannte Frühlingslieder oder Duftöle mit Lavendel, Zitrone oder Rosmarin wirken beruhigend.
Routinen im Freien helfen bei der Orientierung und reduzieren Unruhe.
Angehörige einbeziehen
Der Frühling ist auch eine gute Gelegenheit, Angehörige enger einzubinden:
Gemeinsame Spaziergänge
Gemeinsames Gärtnern oder ein Brunch auf der Terrasse
Fotos und Erinnerungen aus der Kindheit im Frühling austauschen
Fazit: Frühling ist Pflegezeit mit Herz
Der Frühling erinnert uns daran, dass Lebensfreude keine Frage des Alters ist. In der Seniorenpflege kann diese Jahreszeit gezielt genutzt werden, um Gesundheit, Wohlbefinden und soziale Teilhabe zu stärken. Mit etwas Kreativität und Empathie wird der Frühling zu einer echten Kraftquelle – für Pflegende wie Gepflegte.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Foto von Andrea Piacquadio auf pexels.com
Betreuungsurlaub
Pflegende Angehörige im Arbeitsalltag: Wir zeigen, was Ihnen zusteht und worauf Sie achten sollten.
Wer ein krankes Familienmitglied oder den Lebenspartner zu Hause pflegt, leistet oft mehr als nur Unterstützung – es ist eine intensive Aufgabe, die körperlich wie emotional belastend ist. Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf stellt viele Betroffene vor grosse Herausforderungen, insbesondere wenn kurzfristig Hilfe notwendig wird. Umso wichtiger ist es, die gesetzlichen Ansprüche auf Betreuungsurlaub zu kennen.
Was ist Betreuungsurlaub?
Arbeitnehmende in der Schweiz haben Anspruch auf kurzfristigen bezahlten Urlaub, wenn sie sich um ein gesundheitlich beeinträchtigtes Familienmitglied oder ihren Lebenspartner kümmern müssen. Dieser sogenannte Betreuungsurlaub kann bis zu drei Tage pro Ereignis betragen – insgesamt jedoch höchstens zehn Tage pro Kalenderjahr.
Ziel ist es, bei akuten Betreuungssituationen schnell und unbürokratisch zu helfen – zum Beispiel bei einer plötzlichen Erkrankung, einem Unfall oder wenn die reguläre Betreuungsperson unerwartet ausfällt.
Wer gilt als betreuungsberechtigter Angehöriger?
Der Gesetzgeber definiert Familienangehörige in folgendem Rahmen:
- Verwandte in auf- und absteigender Linie: Eltern, Kinder, Geschwister
- Ehepartner und eingetragene Partner
- Schwiegereltern
- Lebenspartner, sofern sie seit mindestens fünf Jahren im gleichen Haushalt wie die pflegende Person leben
Die Voraussetzung für den Anspruch ist, dass die betroffene Person wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kurzfristig auf Betreuung angewiesen ist – also z.B. bei plötzlicher Krankheit, nach einem Unfall oder bei einem Ausfall der üblichen Pflegeperson.
Erhalte ich während des Betreuungsurlaubs meinen Lohn?
Ja, der Anspruch auf Lohnzahlung während des Betreuungsurlaubs ist gesetzlich geregelt. Gemäss Obligationenrecht (OR) Art. 329h erhalten Arbeitnehmende weiterhin ihren vollen Lohn, inklusive allfälliger variabler Lohnbestandteile wie Provisionen oder Boni.
Kann mein Arbeitgeber mir in dieser Zeit kündigen?
Leider besteht während des Betreuungsurlaubs kein spezieller Kündigungsschutz. Das bedeutet: Eine Kündigung durch den Arbeitgeber ist weiterhin möglich, und die Kündigungsfrist läuft normal weiter, auch wenn in dieser Zeit Betreuungsurlaub bezogen wird.
Darf mein Chef die Betreuungsurlaubstage mit meinen Ferien verrechnen?
Nein, der Betreuungsurlaub ist ein gesetzlich separat geregelter Anspruch und darf nicht mit dem regulären Ferienanspruch verrechnet werden – auch nicht anteilig. Das gilt sowohl für gesetzliche Ferien als auch für solche, die im Arbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geregelt sind.
Muss ich ein Arztzeugnis vorlegen?
Laut Obligationenrecht ist ein Arztzeugnis nicht zwingend erforderlich. In der Praxis kann der Arbeitgeber jedoch ein ärztliches Attest verlangen, das die gesundheitliche Beeinträchtigung der betreuten Person bestätigt. Wichtig: Das Zeugnis muss keine Angaben dazu enthalten, ob eine alternative Betreuung möglich oder zumutbar wäre – diese Einschätzung liegt nicht beim Arzt.
Der Arbeitgeber kann ausserdem verlangen, dass das Verwandtschaftsverhältnis oder die Partnerschaft sowie der Betreuungsbedarf glaubhaft gemacht werden.
Muss ich den Betreuungsbedarf beweisen?
Falls der Arbeitgeber Zweifel an der Rechtmässigkeit des Urlaubs hat, kann er verlangen, dass die/der Arbeitnehmende die Voraussetzungen für den Anspruch belegt. In solchen Fällen gilt eine allgemeine Beweislast – man muss also aufzeigen können, dass tatsächlich ein betreuungsbedürftiger Notfall vorliegt und man berechtigt ist, diesen Urlaub zu beanspruchen.
Wird der Betreuungsurlaub an meine Krankheitstage angerechnet?
Nein, der Anspruch auf Betreuungsurlaub ist unabhängig von eigenen Krankheitstagen oder anderen Absenzen und wird separat geführt. Es erfolgt keine Verrechnung mit anderen gesetzlichen Abwesenheitstagen.
Gilt der 10-Tage-Anspruch auch für die Pflege eigener Kinder?
Nein. Für Eltern, die ein gesundheitlich schwer beeinträchtigtes minderjähriges Kind betreuen müssen (z.B. bei schwerer Krankheit oder nach einem Unfall), gibt es eine gesonderte Regelung: In solchen Fällen besteht Anspruch auf 14 Wochen Betreuungsurlaub, der unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. bei Erwerbsausfall) auch über die Erwerbsersatzordnung (EO) entschädigt wird. Dies gilt jedoch nur für Eltern und nicht für andere Angehörige.
Fazit: Unterstützung in belastenden Situationen
Der Betreuungsurlaub ist ein wichtiges Instrument, um kurzfristig auf Notlagen innerhalb der Familie reagieren zu können – ohne dass der Arbeitsplatz oder das Einkommen direkt gefährdet sind. Wichtig ist, die Voraussetzungen und den Umfang des Anspruchs zu kennen, um ihn korrekt und rechtzeitig geltend zu machen.

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungswesen (-> Link)
Bildnachweis: Foto by ChatGPT
Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege
Der Bundesrat hat einen Aktionsplan zur Unterstützung und Entlastung pflegender Angehöriger verabschiedet.
Wie sehen diese Massnahmen aus?
Pflegende Angehörige sollen durch die folgenden vier Massnahmen entlastet werden:
- durch einen vom Arbeitgeber bezahlten Kurzurlaub. Der Kurzurlaub bezieht sich auf Arbeitsabwesenheiten, in denen Arbeitnehmende ein Familienmitglied oder die Lebenspartnerin bzw. den Lebenspartner (gemeinsamer Haushalt seit mindestens fünf Jahren) betreuen. Der Urlaub beträgt höchstens drei Tage pro gesundheitsbezogenes Ereignis und nicht mehr als zehn Tage pro Jahr.
- durch einen über die Erwerbsersatzordnung abgegoltenen längeren Urlaub. Der längere Urlaub gilt für Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise unterbrechen, um ihr gesundheitlich schwer beeinträchtigtes Kind zu betreuen. In diesem Fall haben die Eltern Anspruch auf einen höchstens 14-wöchigen Urlaub, der innerhalb einer Rahmenfrist von 18 Monaten bezogen werden kann. Der Urlaub kann am Stück oder tageweise bezogen und zwischen den Eltern aufgeteilt werden.
- durch eine Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften. Neu gilt der Anspruch auch für Fälle leichter Hilflosigkeit sowie für Paare in Lebensgemeinschaften.
- durch eine Erweiterung des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag bei Spitalaufenthalt von Minderjährigen.
Ausserdem sollen mit einer fünften Massnahme die in den EL berücksichtigten Mietzinsmaxima für Personen in Wohngemeinschaften erhöht werden.
Betreuungsentschädigung (EO)
Die Betreuungsentschädigung ist eine finanzielle Unterstützung für Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen müssen, um ihr schwer gesundheitlich beeinträchtigtes minderjähriges Kind zu betreuen. Anspruch darauf haben Eltern unabhängig vom Zivilstand, wenn ihr Kind aufgrund von Krankheit oder Unfall eine erhebliche und fortdauernde Pflege benötigt. Voraussetzung ist, dass sie entweder erwerbstätig, selbstständig, arbeitslos mit Taggeldern oder krankheitsbedingt arbeitsunfähig sind.
Auch Stief- und Pflegeeltern können unter bestimmten Bedingungen die Entschädigung erhalten. Die Erkrankung des Kindes muss eine einschneidende und unvorhersehbare Veränderung seines Zustands bewirken, wobei eine stabile Behinderung allein nicht ausreicht. Der Anspruch gilt für maximal 14 Wochen innerhalb von 18 Monaten und wird mit 80 % des AHV-pflichtigen Einkommens entschädigt. Die Eltern können die Betreuungstage flexibel aufteilen.
Urlaub für die Betreuung von Angehörigen (Kurzurlaub)
Der Urlaub für die Angehörigenbetreuung ermöglicht es Arbeitnehmenden, bis zu drei Tage pro Ereignis und maximal zehn Tage pro Jahr bezahlt vom Arbeitgeber freigestellt zu werden, um ein gesundheitlich beeinträchtigtes Familienmitglied oder den Lebenspartner zu betreuen. Anspruch haben Arbeitnehmende, die dem Obligationenrecht unterstellt sind.
Als Familienmitglieder gelten Eltern, Kinder, Geschwister, Ehe- und eingetragene Partner sowie Lebenspartner, die seit mindestens fünf Jahren im gleichen Haushalt leben. Der Urlaub ist auch für Angehörige im Ausland möglich, wobei die Modalitäten mit dem Arbeitgeber geklärt werden müssen. Der Lohn wird während des Urlaubs voll ausbezahlt. Die Regelung gilt seit 1. Januar 2021 und ist im Obligationenrecht (Art. 329h) und Arbeitsgesetz (Art. 36 Abs. 3 und 4) verankert.
Betreuungsgutschriften (AHV)
Die Betreuungsgutschriften sind ein fiktives Einkommen, das auf das AHV-Konto angerechnet wird, um die Rente pflegender Angehöriger zu verbessern. Sie sind keine direkte Geldzahlung, sondern erhöhen die spätere AHV-Rente.
Anspruch haben Personen, die in der Schweiz leben oder arbeiten, das Rentenalter noch nicht erreicht haben (Frauen: 64 / Männer: 65) und pflegebedürftige Verwandte betreuen. Seit 1. Januar 2021 zählen auch Lebenspartner nach fünf Jahren gemeinsamen Haushalts dazu.
Die pflegebedürftige Person muss eine Hilflosenentschädigung (AHV, IV, Unfall- oder Militärversicherung) beziehen und darf nicht weiter als 30 km oder eine Stunde entfernt wohnen. Seit 2021 begründet auch eine leichte Hilflosigkeit den Anspruch.
Die Gutschrift entspricht der dreifachen jährlichen Minimalrente und wird unter mehreren betreuenden Angehörigen aufgeteilt. Der Antrag muss jährlich bei der kantonalen Ausgleichskasse während der Betreuung gestellt werden.
Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag (AHV/IV)
Die Hilflosenentschädigung ist eine finanzielle Unterstützung für Personen, die im Alltag regelmässig auf Hilfe Dritter angewiesen sind. Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Grad der Hilflosigkeit (leicht, mittel, schwer).
Anspruch haben IV- und AHV-Versicherte, sowohl Minderjährige als auch Erwachsene. Bei rein psychischen Beeinträchtigungen besteht für Erwachsene nur ein Anspruch, wenn sie mindestens eine Viertelsrente erhalten.
Minderjährige können zusätzlich einen Intensivpflegezuschlag erhalten, wenn sie täglich mindestens vier Stunden zusätzliche Betreuung benötigen. Seit dem 1. Januar 2021 bleibt dieser Zuschlag auch während eines Spitalaufenthalts bestehen, wenn das Spital alle 30 Tage bestätigt, dass die Anwesenheit eines Elternteils notwendig und erfolgt ist.
Weitere Details können Sie über folgenden Link abrufen.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Foto by ChaGPT
Freiwilligenarbeit
Mit 66 fängt das Leben an? Die Generation der Babyboomer tritt in die Rente ein. Es gibt in der Schweiz viele Möglichkeiten für Pensionäre, sich freiwillig für ältere Menschen zu engagieren.
Der Übergang in den Ruhestand bedeutet für viele Menschen eine Zeit, in der sie endlich ihre Freiheit geniessen können. Doch anstatt sich nur dem eigenen Vergnügen zu widmen, entscheiden sich viele Neurentner bewusst dafür, sich daneben auch ehrenamtlich für ältere, oft pflegebedürftige Menschen einzusetzen. Neurentner engagieren sich oft freiwillig für ältere Menschen aus verschiedenen persönlichen, sozialen und emotionalen Gründen.
Sinnstiftung & Erfüllung
- Viele frischgebackene Rentner suchen nach einer sinnvollen Beschäftigung, um weiterhin gebraucht zu werden
- Das Gefühl, etwas Gutes zu tun, kann das persönliche Wohlbefinden steigern
Soziale Kontakte & Gemeinschaft
- Freiwilligenarbeit bietet die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und soziale Bindungen zu stärken
- Sie hilft, Einsamkeit nach dem Berufsleben zu vermeiden
Eigene Erfahrungen weitergeben
- Viele Rentner haben lebenslange Erfahrungen und Fähigkeiten, die sie an ältere Menschen weitergeben möchten
- Sie können als Mentoren oder Unterstützer fungieren
Empathie & Dankbarkeit
- Wer seine eigenen Eltern oder ältere Verwandte gepflegt hat, entwickelt oft Mitgefühl für die Herausforderungen im Alter
- Manche engagieren sich aus Dankbarkeit, weil sie selbst Unterstützung erfahren haben
Eigene Zukunftsperspektive
- Der Umgang mit noch älteren Menschen sensibilisiert für das eigene Altern
- Man kann aus erster Hand lernen, wie andere mit dem Älterwerden umgehen
Aktiv bleiben & geistige Fitness
- Helfen hält körperlich und geistig fit, indem es neue Aufgaben und Herausforderungen bietet
- Struktur im Alltag sorgt für einen gesunden Lebensrhythmus
Religiöse oder ethische Überzeugungen
- Manche engagieren sich aus christlicher oder humanitärer Motivation
- Werte wie Nächstenliebe oder Solidarität spielen eine große Rolle
Gesellschaftliche Verantwortung & Generationensolidarität
- Viele fühlen sich verpflichtet, der Gesellschaft etwas zurückzugeben
- Der demografische Wandel macht freiwilliges Engagement besonders wertvoll
Welche Engagements gibt es in der Schweiz und wie profitieren sowohl die Freiwilligen als auch die Gesellschaft davon?
Besuchs- und Begleitdienste
- Pro Senectute: Begleitung und Unterstützung älterer Menschen im Alltag, z. B. durch Besuche, Spaziergänge oder gemeinsames Einkaufen.
- Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK): Besuchs- und Begleitdienste für einsame ältere Menschen, oft kombiniert mit Fahrdiensten.
- Verein Senioren für Senioren: Unterstützung von SeniorInnen durch SeniorInnen (z. B. bei alltäglichen Aufgaben oder als Gesprächspartner).
- Zeitvorsorge (z. B. in St. Gallen, Zürich oder Bern): HelferInnen unterstützen ältere Menschen und sammeln Zeitgutschriften, die sie später selbst einlösen können.
Fahr- und Mahlzeitendienste
- Rotes Kreuz Fahrdienst: Fahrten für ältere Menschen zu Arztterminen oder sozialen Aktivitäten.
- Essen auf Rädern: Auslieferung von Mahlzeiten an SeniorInnen, die nicht mehr selbst kochen können.
Unterstützung im digitalen Bereich
- Seniorweb oder Silver Surfer Programme: Hilfe für ältere Menschen im Umgang mit Smartphones, Computern oder dem Internet.
- Verein Connect: Unterstützung bei der Nutzung digitaler Technologien, um soziale Isolation zu verringern.
Wohngemeinschaften und Altersheime
- Freiwilligenarbeit in Alterszentren: Unterstützung durch Besuche, Aktivitäten (z. B. Spiele, Vorlesen, Musik) oder kleine Handreichungen.
- Demenzbegleitung: Spezielle Programme für die Betreuung und Begleitung von Menschen mit Demenz, z. B. durch Alzheimer Schweiz.
Gemeinsame Freizeitaktivitäten & Mentoring
- Pro Senectute Sport- und Freizeitangebote: Wandergruppen, Gymnastik oder Tanz für ältere Menschen organisieren.
- Senioren-Mentoring: Jüngeren Senioren helfen, sich im Ruhestand zurechtzufinden.
Freiwilligenplattformen für Seniorenhilfe
- Benevol Schweiz – Vermittlung von Freiwilligenarbeit.
Sie möchten uns weitere Angebote für Freiwilligenarbeit melden? Gerne per Mail unter kontakt@pflegeinfo.ch

Quelle: Eigenbeitrag von Pflegeinfo.ch: Interview mit Sarah Buser
Bildnachweis: Bild Sarah Buser
Angehörigen- und Trauerbegleitung
Der Verlust eines geliebten Menschen stellt das Leben auf den Kopf und hinterlässt oft eine Leere, die schwer zu füllen ist. Im Interview mit Sarah Buser möchten wir einen Blick auf die Bedeutung von Angehörigen- und Trauerbegleitung werfen, und erfahren, wie Trauernde in dieser schwierigen Zeit bestmöglich unterstützt werden können.
Wie bist Du zur Angehörigen- & Trauerbegleitung gekommen? Was hat Dich dazu inspiriert, diesen Weg einzuschlagen?
Es war ein natürlicher Prozess. In der Rolle als Angehörige bin ich schon früh mit Krankheit, dem Sterben & dem Tod konfrontiert worden. Ich durfte lernen, was es heisst zu trauern. Ich durfte lernen eine mir nahestehende Person in ihrem Sterbeprozess zu begleiten. Ich durfte als Angehörige mir sehr nahestehende, erkrankte Menschen begleiten. So traurig und herausfordernd jede einzelne Situation war, ich kam ich jeweils stärker aus diesen Situationen raus – auch wenn es im ersten Moment überhaupt nicht danach aussah.
Meine eigenen Erfahrungen, das Bewusstsein, dass wir noch viel zu wenig über das Loslassen, Sterben und den Tod sprechen und dass Angehörige von erkrankten Personen noch viel zu oft vergessen gehen, haben mich dazu inspiriert meinen Herzensweg zu gehen.
Mit meiner professionellen Unterstützung biete ich einen sicheren Raum für begleitende, pflegende und trauernde Angehörige, wo sie durchschnaufen können, ihre Bedürfnisse wieder wahrnehmen können, ihren (Trauer-)Prozess in ihrem Tempo gehen und mit neuen, individuellen Werkzeugen gestärkt in ihren anspruchsvollen Alltag zurückkehren können. Immer mit dem Ziel sich in diesen schweren Zeiten nicht selbst zu vergessen und trotz viel Dunkelheit wieder das Licht zu erblicken.
Gibt es spezielle Techniken/Methoden oder Rituale, die Du in Deiner Arbeit nutzt, um die Angehörigen in ihren herausfordernden Situationen zu unterstützen?
Wenn eine Person sich entscheidet zu mir in die Begleitung zu kommen, dann trifft sie auf eine sehr aufmerksame Zuhörerin. Ich biete viel Raum für Gedanken, Gefühle und Austausch. Mit meinem Zuhören, meinen Fragen und Inputs ermögliche ich meinem Gegenüber den Umgang mit seinen Gefühlen zu erkunden, seine eigenen Ressourcen zu aktivieren, die Selbstwirksamkeit zu stärken und seine eigenen Rituale zu entdecken. Damit wir zusammen Lösungsansätze erarbeiten können, gehe ich mit den Menschen gerne auf einen Spaziergang. Natürlich nur, wenn es die Umstände zulassen und es von meinem Gegenüber auch gewollt ist. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass ein Spaziergang an der frischen Luft und das bewusste Wahrnehmen der Natur einen Prozess in Gang setzen kann. Auch freies Schreiben, wo Gedanken auf einem weissen Blatt Papier deponiert werden können, kann schon Einiges bewirken. Meine Rolle als Begleiterin ist es dann, die Erkenntnisse zu spiegeln, um daraus mit meinem Gegenüber eine passende, alltagtaugliche Strategie zu entwickeln, um wieder leichter in die Zukunft blicken zu können.
Wie unterschiedlich erleben Menschen Trauer und wie passt Du die Begleitung an die individuellen Bedürfnisse an?
So unterschiedlich und individuell wir Menschen sind, so trauern wir auch ganz unterschiedlich. Manche Menschen erleben nebst grosser Traurigkeit auch Wut und Angst. Andere verdrängen die aufkommenden Gefühle / Gedanken und wieder andere verlieren sich in einem negativen Gedankenstrudel, der nur schwer allein zu durchbrechen ist. Darum ist es so wichtig, dass ich den Menschen zuhöre, um dann gemeinsam mit meinem Gegenüber den individuellen Prozess starten und gestalten zu können. Immer mit dem Ziel, Stück für Stück in einen unbeschwerteren Alltag und in sein eigenes Leben zurückzufinden.
Gibt es einen besonderen Fall oder eine Erfahrung in Deiner Arbeit, die Dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja. Und zwar ist es keine einzelne Erfahrung, sondern eine Erfahrung, die ich immer wieder machen darf. Es gibt während den Begleitungen oft einen ganz speziellen Moment, welcher jeweils mein Herz erwärmt. Und zwar immer dann, wenn mein Gegenüber sich selbst wiederentdeckt und genau weiss was zu tun ist, damit wieder Momente des Glücks spürbar sind. Dann stellt sich meistens eine wunderbare «Ich pack das» Energie ein, häufig mit einem Lächeln oder Leuchten in den Augen verbunden. Einfach wundertoll.
Wie gehst Du selbst mit der emotionalen Belastung um, die mit dieser Arbeit verbunden ist?
Ich lasse mich selbst regelmässig professionell begleiten. Dies um mich, meine Arbeit und mein Wirken zu reflektieren und auch schwierige Momente deponieren zu können. Was bei mir für mein eigenes Wohlbefinden aber auch unbedingt dazu gehört, ist die Bewegung draussen in der Natur. Am liebsten in den Bergen auf dem Bike, den Skis oder zu Fuss.

Quelle: Beitrag veröffentlicht auf watson.de (-> Link)
Bildnachweis: presse german bionic
Hilfe beim Heben:
Pflegekräfte in der Charité tragen Exoskelette
Der Alltag in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist für das dortige Personal mit hohen körperlichen Belastungen verbunden, die in vielen Fällen auch zu einem frühen Ausscheiden aus dem Beruf führen. Ein großer Teil dieser Belastungen besteht im Heben von Patient:innen.
Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und das Personal zu entlasten, werden in der Berliner Charité aktuell sogenannte Exoskelette getestet. Konkret geht es dabei um Assistenzsysteme, die direkt am Körper getragen werden. Diese entlasten den Tragenden durch eine Kraftunterstützung und werden bislang vor allem in Lagerhallen verwendet.
Die in der Charité verwendeten Exoskelette wurden vom Start-up „German Bionic“ entwickelt, das Forschende aus Berlin und Augsburg zusammenbringt. Im vergangenen Jahr erhielt das Konzept auf der weltgrößten Elektronikmesse CES in Las Vegas bereits den Preis „Best of Innovation“.
Zunächst wurden die Roboteranzüge vor allem zum Bewegen von schweren Gegenständen in der Industrie, im Handwerk, bei Logistik-Unternehmen oder bei der Gepäcksortierung auf Flughäfen eingesetzt.
Bei Exoskeletten unterscheidet man allgemein passive und aktive Systeme. Systeme im Industrieumfeld etwa arbeiten zumeist passiv. Sie haben Federn oder Expander, die unter mechanischer Spannung stehen und bei bestimmten Körperhaltungen ihre Energie wieder freisetzen.
Bei der Version für Pflegekräfte handelt es sich hingegen um ein aktives System, das elektrisch betrieben wird.
Personal an der Charité begeistert von Exoskeletten
Laut einem Bericht der Deutschen Welle werden die Roboteranzüge schon seit 2021 an der Charité getestet. Das Modell „Apogee+“ ist nun ganz neu und wurde konkret an die Verwendung in der Pflege angepasst.
So lassen sich die Exoskelette unter anderem leichter desinfizieren und sind mit Griffen für Patient:innen ausgestattet. Das Gewicht wird dabei weg vom Rücken auf Schultern und Beine verteilt.
Die Wirkung des Pflegeexoskeletts soll jetzt in einer Studie weiter untersucht werden. Die Leiterin der Pflegeforschung an der Charité hofft, mit der Innovation auch ein Mittel gegen den Fachkräftemangel gefunden zu haben.

Quelle: Beitrag veröffentlicht auf stadt-zuerich-ch (-> Link)
Bildnachweis: Bild von Neisa Ploudan auf Linkedin
Exzellenz in der Pflege:
Kinaesthetics
«Der Mensch ist dafür gemacht, sich selbstwirksam zu erfahren – vom Moment, in dem er geboren wird, bis zu seinem Tod.»
Neisa Plouda, Kinaesthetics-Trainerin
im Gesundheitszentrum für das Alter, Käferberg
Neisa Plouda ist im Gesundheitszentrum für das Alter Käferberg als Kinaesthetics-Trainerin Stufe 3 tätig. Das ist die höchste Stufe und bedeutet, dass sie Aufbaukurse anbieten und Peer-Tutor*innen ausbilden kann. Bei den Gesundheitszentren arbeiten zudem neun Trainer*innen der Stufe 2, die Grundkurse anbieten können, sowie zahlreiche Spezialist*innen für angewandte Kinaesthetics, die Refresher-Kurse gestalten.
Die Definition des Berufsverbands Kinaesthetics Schweiz lautet: Kinaesthetics ist die Bezeichnung für die Erfahrungswissenschaft, die sich mit Bewegungskompetenz als einer der zentralen Grundlagen des menschlichen Lebens auseinandersetzt. Was das für die Pflege bedeutet, erläutert Neisa Plouda im Interview.
Neisa, wie würdest du Kinaesthetics beschreiben?
Kinaesthetics hat viel mit Physik zu tun – aber nicht nur. Es geht darum, wie wir das Gewicht in der Schwerkraft organisieren. Kinaesthetics bedeutet, Interaktionen so zu gestalten, dass sie für das Gegenüber passend sind. Das heisst, wir leiten in der Pflege durch Berührung und Bewegung so an, dass die Anstrengung der Tätigkeit angepasst ist. Wenn die Interaktion vom Pflegepersonal nicht passend gestaltet ist, bringen wir das Gewicht des Bewohners in die Muskulatur. Dadurch wird die Anstrengung für den Bewohner grösser – und die Pflegeperson empfindet die Tätigkeit als Strapaze. Kinaesthetics betrifft aber nicht nur die Anleitung durch Berührung und Bewegung, sondern auch unsere Art zu kommunizieren.
Kinaesthetics in der Kommunikation?
Absolut. Wenn ich eine Situation in einem Rapport so beschreibe, dass sie von meiner Kollegin, die übernimmt, als negativ und mühsam wahrgenommen wird, tritt sie ihren Dienst mit einer hohen Körperspannung an – denn Spannung erzeugt Spannung. Wenn ich die Situation im Rapport jedoch als Herausforderung beschreibe, zu der ich ihre Meinung schätze und ihr eine Fallbesprechung anbiete, löst das völlig andere Gefühle aus.
Kannst du uns ein Beispiel für Kinaesthetics aus dem Pflegealltag geben?
Gerne. Nehmen wir Frau M. Sie hat eine demenzielle Erkrankung und zeigt sehr viel Angst beim Wechsel von der Rückenlage in die Seitenlage. Sie kann sich kaum noch körperlich orientieren, das heisst, ihre räumliche und zeitliche Orientierung sind nicht mehr gegeben. Meine Absicht ist es nun, Frau M. in ihrer Bewegung so zu unterstützen, dass sie diese nachvollziehen kann. So lernt sie, sich in ihrem Körper wieder zurechtzufinden. Dadurch reduzieren sich ihre Angst und Anspannung.
Wie machst du das konkret?
Ich gestalte die Umgebung so, dass sie Frau M. Sicherheit gibt. Wenn sie etwa Angst zeigt, beim Drehen in die Seitenlage auf den Boden zu fallen, achte ich darauf, dass ihre Aufmerksamkeit auf mich gerichtet ist und nicht auf die Bewegung. Diese einfach klingende Absicht unterteilt sich in eine Vielzahl kleiner Schritte, die ich im Bewegungsablauf beachte, damit Frau M. sich selbstwirksam erfahren kann und ihre Angst in den Hintergrund tritt.
Wie stellst du einen Draht zu den Bewohnenden her?
Indem ich sie in dem bestärke, was sie können und was sie gerade tun. Das beginnt mit dem Blickkontakt und der Begrüssung, einem Händedruck und persönlichen Worten. Ich nehme den Menschen in seiner jetzigen Situation als Ganzes wahr – und ernst. Wenn eine Bewohnerin zum Beispiel die Bettdecke festhält, unterstütze ich sie dabei. So wird ihre aktuelle Tätigkeit – egal mit welcher Absicht oder Motivation – von ihr als positiv erfahren. Sie erlebt sich als selbstwirksam. Das heisst, sie kann selbst etwas zu dem, was gemacht werden soll, beitragen.
Warum ist Selbstwirksamkeit so wichtig?
Der Mensch ist dafür gemacht, sich selbstwirksam zu erfahren – vom Moment, in dem er geboren wird, bis zu seinem Tod. Ein kleines Kind möchte selbst essen, auch wenn es dabei alles vollkleckert, es möchte allein in den Kindergarten gehen und selbst über sein Spielzeug entscheiden. Jeder Mensch ist anders und entwickelt im Lauf seines Lebens eigene Muster, Gewohnheiten, Ängste und Freuden. Und jeder Mensch ist ein in sich geschlossenes System.
Kannst du das genauer erklären?
Jeder Mensch kann sich nur selbst wahrnehmen und spüren – und sein eigenes Spannungsnetz regulieren. Wenn meine Körperspannung bei einer Interaktion steigt, sodass sie für die Tätigkeit, die ich ausführen will, nicht mehr passend ist, bewirke ich das Gleiche auch bei meinem Gegenüber. Angst, Schmerz, Unwohlsein: Das alles erhöht die Körperspannung. Dabei handelt es sich um einen Schutzmechanismus des Körpers. Alles, was weich und intim ist, wird zugemacht, um Verletzungen vorzubeugen. Auch verbale Verletzungen erzeugen beim Menschen eine höhere Körperspannung. Kinaesthetics-Trainer*innen werden darin geschult, sich selbst bei jeder Interaktion wahrzunehmen, um feinste Anpassungen in Bezug auf sich vornehmen zu können.
Wie lässt sich die Selbstwirksamkeit in der Pflege fördern?
Indem ich Bewegungen für die Bewohnenden nachvollziehbar gestalte. Dazu gebe ich gerne ein Beispiel. Wenn ich einem Bewohner, der schon seit Jahren auf Hilfe angewiesen ist, das Bein im Bett immer aufstelle, mache ich das für ihn satt mit ihm. Er kann dann zwar das Bein angewinkelt halten, verlernt aber, wie er es aus eigenem Antrieb anwinkeln kann. Wenn ich den Bewegungsablauf hingegen so gestallte, dass er für ihn nachvollziehbar ist, kann er sich einbringen und Selbstwirksamkeit erfahren. Idealerweise gelingt es ihm so irgendwann, sein Bein wieder allein aufzustellen.
Was lernen die Mitarbeitenden, die du schulst, von dir?
Zwei wichtige Erkenntnisse sind: Wenn ich meine Anspannung und Anstrengung der Tätigkeit anpasse, die ich ausführe, reguliert sich auch die Anspannung und Anstrengung der Bewohnenden. Wenn ich achtsam bin mit mir selbst, werde ich auch achtsam in Bezug auf die Bewohnenden – und die pflegerischen Abläufe fallen mir leichter. Diese Erkenntnisse bereiten ihnen Freude. Und es macht sie stolz, wenn sie einen Bewohner, den sie bis anhin zu zweit gepflegt haben, neu allein pflegen können. Das führt dazu, dass sie Pflegesituationen nicht einfach als schwierig wahrnehmen, sondern als eine lösbare Herausforderung. Zudem lernen sie von mir, dass auch ich ständig am Forschen und Suchen bin.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Bild von Josh Appel auf Unsplash
Prämienverbilligung in der Krankenversicherung
Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen haben Anrecht auf finanzielle Unterstützung in Form von individuellen Prämienverbilligungen. Ziel ist die Belastung durch die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu mindern.
Wie muss der Versicherte vorgehen, um eine Krankenkassenverbilligung zu erhalten?
Wer hat Anspruch auf Individuelle Prämienverbilligungen (IPV)?
Die Bedingungen für den Erhalt der Prämienverbilligung (Einkommens- und Vermögensgrenzen), die Höhe und die Art der Auszahlung der Prämienverbilligung (automatisch oder auf Antrag, Frist) sind je nach Wohnkanton verschieden.
In der Schweiz haben Einzelpersonen sowie Paare und Familien Anspruch auf individuelle Prämienverbilligungen, die bestimmte Kriterien erfüllen.
Im Allgemeinen haben Personen Anspruch, wenn:
- ihr Jahreseinkommen und Vermögen unter einer bestimmten Grenze liegt
- die bei einer vom Bund anerkannten Krankenkasse obligatorisch nach KVG versichert sind
Wie müssen Sie vorgehen, um eine Krankenkassenverbilligung zu erhalten?
In den meisten Kantonen werden die Beiträge aufgrund der Steuereinschätzung automatisch zugesprochen. In bestimmten Kantonen muss man jedoch bei der zuständigen Stelle einen Antrag einreichen. Dabei sind in den meisten Fällen Fristen einzuhalten.
Die kantonalen Stellen zur Beantragung der Prämienverbilligung finden Sie über den folgenden Link:
https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Stellen-zur-Pr%C3%A4mienverbilligung
Für die Prämienverbilligung von Versicherten, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island oder in Norwegen wohnen und eine schweizerische Rente beziehen und deren Familienangehörigen, ist die Gemeinsame Einrichtung zuständig: https://www.kvg.org/
Wie hoch ist die individuelle Prämienverbilligung?
Die Höhe der individuellen Prämienverbilligung in der Schweiz hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Einkommen, die Vermögenssituation, die Anzahl der Familienmitglieder und der Wohnort des Antragstellers. Da die Schweiz föderalistisch organisiert ist, variieren die genauen Regelungen und Beträge von Kanton zu Kanton.
Veränderungen im jeweiligen Prämienverbilligungsanrecht werden der Krankenkasse automatisch gemeldet. Dies dauert in der Regel einige Wochen. Die Änderungen werden auf den Zeitpunkt der Änderung rückwirkend berücksichtigt.
Muss bei einem Krankenkassenwechsel die zuständige kantonale Stelle informiert werden?
Nein, die Informationen werden direkt vom Krankenversicherer an das zuständige Amt gemeldet.
Welcher Kanton ist bei einem unterjährigen Umzug in einen anderen Kanton zuständig?
Für die Prämienverbilligung für das ganze Jahr ist derjenige Kanton zuständig, in dem die versicherte Person am 1. Januar ihren Wohnsitz hatte.
Was gilt für Personen mit Bezug von Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen?
Personen, die Leistungen der Sozialhilfe beziehen, haben Anrecht auf die ordentliche Prämienverbilligung. Die Prämienverbilligungsbeiträge werden direkt an den zuständigen Sozialdienst ausbezahlt.
Personen, die Ergänzungsleistungen zur AHV oder IV erhalten, haben Anrecht auf einen Beitrag an die Krankenkassenprämie. Der Beitrag wird direkt an Ihre Krankenkasse ausbezahlt. Diese richtet den Beitrag an die versicherte Person aus. Bezieht die versicherte Person keine Ergänzungsleistungen mehr, muss sie um weiterhin Prämienverbilligung zu erhalten, einen Antrag stellen.

Quelle: Beitrag veröffentlicht auf test.de (-> Link)
Bildnachweis: Foto von mark paton auf unsplash
Was Sie über Hörgeräte wissen sollten
Mit den großen Klötzen hinterm Ohr, die einige mit dem Stichwort Hörgerät verbinden, haben Hörhilfen heutzutage nur noch wenig gemein. Moderne Systeme sind unauffällige Hightech-Maschinchen. Fast alle haben Programme für verschiedene Hörsituationen, viele lassen sich dank Funkzubehör wie Bluetooth mit anderen Geräten koppeln.
Welche Hörgeräte-Arten gibt es ?
Hörgeräte sind heute in Design und Bauart sehr unterschiedlich, ihre Grundfunktion gleicht sich aber: Alle haben ein Mikrofon, einen Verstärker und einen Lautsprecher. In den modernen digitalen Geräten steckt zudem einen Mikroprozessor, der den Schall verarbeitet. Ob digital oder analog – am gängigsten sind in beiden Fällen zwei Arten:
Beim Typ „Hinter dem Ohr (HdO)“ sitzt das Gehäuse hinterm Ohr. Ihn gibt es mit externem Hörer oder Schallschlauch. Der Typ „In dem Ohr (IdO)“ wird direkt im Gehörgang platziert und individuell angepasst.
Die Lautstärke regelt man bei IdO-Systemen meist über eine Fernbedienung, manche dieser Geräte regulieren sich auch automatisch. Die Im-Ohr-Variante ist unauffälliger, eignet sich aber nur bei leichtem oder mittlerem Hörverlust.
Bei Patienten, die wegen einer Schädigung des Innenohrs taub sind, kann ein Cochlea-Implantat (CI) helfen. Diese elektronische Hörprothese besteht aus einem äußeren und einem in den Schläfenknochen eingesetzten inneren Bauteil. Dieses reicht bis in die Hörschnecke des Innenohres.
Wie werden die Geräte mit Energie versorgt?
Lange Zeit waren Zink-Luft-Batterien im Knopfzellenformat der Standard. Mittlerweile gibt es auch Akkugeräte, die zum Laden in eine spezielle Ladestation gestellt werden. Wer eine Ladestation mit USB-Anschluss besitzt, kann seine Hörgeräte auch außer Haus laden. Vorteil: Man muss keine Batterien nachkaufen und wechseln. Nachteil: Die Betriebsdauer des Geräts ist deutlich kürzer. Akkus leeren sich zehnmal schneller als Batterien.
Techniken, die den Alltag erleichtern
Was bringt Bluetooth?
Mit diesem Funkzubehör lassen sich Smartphones, Fernseher und andere Multimediageräte drahtlos mit dem Hörgerät koppeln. Die Audiosignale von Handy und Co. werden über das Hörgerät direkt ins Ohr übertragen, alle störenden Hintergrundgeräusche herausgefiltert.
Wie funktioniert eine T-Spule?
Sie ist in vielen Hörgeräten und allen Cochlea Implantaten eingebaut: die T-Spule (auch Induktionsspule). Sie erleichtert das Hören in öffentlichen Gebäuden wie Kirchen, Theatern und Kinos, wenn diese eine induktive Höranlage haben. Das Prinzip dahinter: Die Spule – die sich dank ihrer geringen Größe sogar in IdO-Geräte einbauen lässt – empfängt ein elektromagnetisches Signal der Anlage und leitet den Schall direkt in das Hörgerät. Wie auch bei der Bluetooth-Methode wird das Hörsystem so zum kabellosen Lautsprecher im Ohr. Wer ein Telefon mit Induktionsspule besitzt, kann sich auch den Ton des Gesprächspartners direkt in sein Hörgerät übertragen lassen.
Was kann ich tun, damit das Telefonieren gut klappt?
Stark Schwerhörige fahren oft am besten, wenn sie ihr Telefon über eine Funkübertragung an das Hörgerät koppeln. Neben der günstigeren Option der T-Spule (die aber nicht in allen modernen Telefonen eingebaut ist) bietet sich auch die Bluetooth-Technologie an. Ist die Schwerhörigkeit nur leicht oder mittelstark ausgeprägt, kann es sinnvoll sein, ohne das Hörgerät zu telefonieren. Das Telefon sollte man dann möglichst laut stellen und den Hörer dicht ans Ohr drücken.
.

Quelle: Beitrag von akbern.ch (-> Link)
Bildnachweis: Foto von Rollz International auf Unsplash
Betreuungsgutschriften
für die Pflege von Angehörigen
Pflegende und berufstätige Angehörige riskieren Einkommensverluste.
Wie können Betreuungsgutschriften helfen?
Wer kann sie wie beantragen?
Was ist eine Betreuungsgutschrift ?
Betreuungsgutschriften sollen dazu beitragen, Rentenlücken zu vermeiden, die durch die Betreuung von pflegebedürftigen Familienmitgliedern entstehen können. Die Gutschriften stellen keine direkten Geldleistungen dar, sondern erhöhen das durchschnittliche Jahreseinkommen, welches Basis für die Berechnung einer AHV- oder IV-Rente ist.
Wer hat Anspruch auf Betreuungsgutschriften ?
Betreuungsgutschriften werden gewährt, wenn die folgenden Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind:
- Die betreuende Person muss weniger als 30 km von der pflegebedürftigen Person entfernt wohnen oder diese in weniger als einer Stunde erreichen können
- Die betreuende Person und die pflegebedürftige Person müssen eng miteinander verwandt sein (Ehegatte, Lebenspartner, Eltern, Geschwister, Grosseltern, Schwiegereltern, Kinder)
- Die pflegebedürftige Person muss eine Hilflosenentschädigung beziehen. Es spielt keine Rolle, welchen Grad der Hilflosigkeit die betreute Person aufweist. Die Hilflosenentschädigung kann von der AHV, der Invalidenversicherung (IV), der Unfallversicherung (UV) oder der Militärversicherung stammen
- Betreuungs- und Erziehungsgutschriften, d.h. bei Kindern unter 16 Jahren, können nicht gleichzeitig beansprucht werden
- Betreuungsgutschriften können nur Personen gewährt werden, die noch keine AHV-Rente erhalten
Wo kann die die Betreuungsgutschrift geltend gemacht werden?
Die Betreuungsgutschrift muss jährlich bei der kantonalen Ausgleichskasse im jeweiligen Wohnsitzkanton geltend gemacht werden. Die Formulare für die Anmeldung können bei den Ausgleichskassen und ihren Zweigstellen oder unter www.ahv-iv.ch bezogen werden.
Die genauen Bedingungen für den Anspruch auf Betreuungsgutschriften können je nach Kanton und den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen variieren. Es ist ratsam, sich direkt an die zuständigen Behörden oder Stellen zu wenden, um genaue Informationen über die Anspruchsvoraussetzungen und den Antragsprozess zu erhalten.
Werden die Betreuungsgutschriften bei mehreren Betreuungspersonen aufgeteilt?
Beteiligen sich mehrere Personen an der Betreuung, wird die Betreuungsgutschrift unter ihnen aufgeteilt. Zum Beispiel wird bei verheirateten Personen die Betreuungsgutschrift während der Ehejahre aufgeteilt und je zur Hälfte den Ehegatten angerechnet. Die AHV nimmt diese Aufteilung aber nur vor, wenn beide Ehegatten bei der AHV/IV versichert sind.
Wie hoch ist die Betreuungsgutschrift?
Die Jahre, für die Ihnen eine Betreuungsgutschrift angerechnet werden kann, werden im Individuellen Konto eingetragen. Der genaue Betrag wird erst zum Zeitpunkt der Rentenberechnung festgesetzt.
Die Betreuungsgutschrift entspricht der dreifachen jährlichen Minimalrente zum Zeitpunkt des Rentenanspruchs. Die Summe der Betreuungsgutschriften wird durch die Beitragsdauer geteilt und dann zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen dazugezählt. Pro Kalenderjahr darf höchstens eine ganze Gutschrift angerechnet werden. Die Betreuungsgutschriften erhöhen somit das bei der Rentenberechnung berücksichtigte AHV-pflichtige Einkommen und bewirken eine entsprechend höhere Rente. Die Betreuungsgutschrift ist aber nur bis zum Erreichen der Maximalrente rentenwirksam.

Quelle: Beitrag auf gutaltern.ch (→ Link).
Bildnachweis: Bild von Delphine Roulet Schwab auf gutaltern.ch
«Misshandlungen sind nicht immer von schlechten Absichten getrieben.»
Die Lausanner Professorin Delphine Roulet Schwab forscht seit Jahren zu Gewalt im Alter. Sie sagt: «Das Hauptrisiko liegt in Situationen, in denen wir anstelle der Person entscheiden oder sie einfach behandeln, als wäre sie ein Objekt, das ernährt und bewegt werden muss.»
Zur Person
Delphine Roulet Schwab, Dr. phil. Psychologie, 43 Jahre, ist Professorin an der Fachhochschule für Gesundheit La Source (HES-SO) in Lausanne. Sie lehrt und forscht im Bereich Alterung. Zudem präsidiert sie den Westschweizer Verein «Alter Ego», der sich in der Gewaltprävention für alte Menschen engagiert. Sie ist auch Präsidentin von Gerontologie CH und des Nationalen Kompetenzzentrums Alter ohne Gewalt.
Wie definieren Sie Gewalt im Alter?
Delphine Roulet Schwab: Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den Sprachen: auf deutsch spricht man von «Gewalt», während im Französisch der Begriff «maltraitance», also «Misshandlung» gebräuchlich ist. Aber beide Male geht es nicht um eigentliche Konflikte, sondern um Handlungen oder Verhaltensweisen, welche die Integrität des älteren Menschen tiefgreifend beeinträchtigen. Es gibt verschiedene Arten von Gewalt oder Misshandlungen. Zuerst denkt man dabei an physische Gewalt. Aber psychische Gewalt ist viel häufiger. Also alles, was mit Demütigung, Herabsetzung, Druck, Infantilisierung zu tun hat. Auch finanzielle Misshandlungen sind sehr häufig. Also beispielsweise, wenn jemand für seinen älteren Elternteil die Einkäufe erledigt, ohne ihm zu sagen, seine Kreditkarte gleichzeitig auch für die eigenen Besorgungen benutzt zu haben.
Auch Vernachlässigung ist eine Form der Misshandlung: dass man nicht auf die Bedürfnisse eines abhängigen älteren Menschen eingeht. Dazu gehören, einer Person eine Ernährung oder körperliche Aktivitäten aufzuzwingen, die nicht ihren Fähigkeiten oder Wünschen entsprechen. Oder von ihr verlangt, in einer Wohnung zu leben, die ungenügend beheizt wird oder die sie nicht mehr selbstständig verlassen kann.
Weshalb kommt es zu Gewalt an älteren Menschen?
Delphine Roulet Schwab: Diese Misshandlungen gegen ältere Menschen sind nicht immer von schlechten Absichten getrieben. Im Gegenteil: Vielleicht meinen es die Angehörigen oder Fachkräfte gut, aber sie berücksichtigen nicht, was die Person will und kann. Und manchmal tun sie Dinge, die sie für richtig halten, ohne sich zu fragen, ob das für die betreute Person wirklich wichtig ist. Wir sprechen hier oft von erschöpften Angehörigen, die engagiert sind und ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Wenn man ihnen dann auch noch sagt, dass sie Misshandlungen begehen, ist das für sie sehr schwer zu akzeptieren. Anders hingegen, wenn man ihnen sagt: «Ich sehe, dass Sie versuchen, das Beste zu tun, aber vielleicht hat Ihre Mutter andere Prioritäten.»
Was ist die grösste Herausforderung, wenn wir in der Schweiz das Risiko reduzieren wollen, dass ältere Menschen Opfer von Gewalt werden?
Delphine Roulet Schwab: Das Hauptrisiko liegt in Situationen, in denen wir aus den Augen verlieren, dass wir eine Person vor uns haben mit einer Geschichte, Rechten und einem eigenen Willen, und in denen wir anstelle der Person entscheiden oder sie einfach behandeln, als wäre sie ein Objekt, das ernährt, bewegt usw. werden muss. Deshalb besteht die Hauptherausforderung darin, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass ältere Personen Menschen wie alle anderen sind. Sie haben die gleichen Rechte und den gleichen Stellenwert in der Gesellschaft.
Die altersbedingte Diskriminierung war aber gerade während der Pandemie sehr stark spürbar. Da hiess es: «Die Krankheit ist nicht so schlimm, weil sie ja NUR ältere Menschen tötet» oder «Menschen über 65 Jahre sind gefährdet. Sie müssen zu Hause bleiben, damit die Gesellschaft weiterlaufen kann». Also werden Menschen einzig nach dem Kriterium ihres Alters unterschiedlich behandelt und nicht nach ihren Fähigkeiten, ihren Interessen, ihren Lebensweisen oder ihren Werten.
Ältere Menschen sollen sich zu Themen, die für sie wichtig sind, selbst ausdrücken können. Ich nehme an verschiedenen nationalen Arbeitsgruppen teil, aber sehr selten sitzen Seniorenorganisationen mit am Tisch. Das ist ein echtes Problem: wir nehmen diese Haltung ein, dass wir Experten seien und wüssten, was gut für ältere Menschen sei. Womit wir wieder bei der ersten Frage mit den Themen Infantilisierung und Machtmissbrauch sind. Für mich liegt hier die Hauptherausforderung.
Sie forschen zu unterschiedlichen Aspekten der Gewalt im Alter. Was steht im Moment im Fokus ihrer Arbeiten?
Delphine Roulet Schwab: Derzeit arbeite ich zu einem Projekt zur Gewalt bei älteren Paaren. Die Fachhochschule für Gesundheit La Source (HES-SO), das Nationale Kompetenzzentrum Alter ohne Gewalt und das senior-lab haben festgestellt, dass ab dem 60. Altersjahr Gewalt in der Partnerschaft völlig vom Radar verschwindet. Wenn man sich die entsprechenden Statistiken anschaut, sieht man, dass es sehr wenige ältere Menschen gibt, die Hilfsangebote nutzen oder sich beraten lassen. Wir wissen aber, dass es auch im Alter Gewalt in der Partnerschaft gibt und dass es keinen Grund gibt, dass diese plötzlich verschwindet, weil man 60 oder 65 Jahre alt ist.
Mit diesem Projekt wollen wir einerseits die Besonderheiten der Gewalt bei älteren Paaren und andererseits die Art der Zusammenarbeit der Fachleute in diesem Bereich besser verstehen. Denn es gibt einerseits Fachleute der Hilfe, Betreuung und Pflege für ältere Menschen, andererseits Fachleute im Bereich der Prävention von häuslicher Gewalt. Aber es gibt nur wenig Zusammenarbeit zwischen ihnen. Um die Nutzung der bestehenden Angebote zu verbessern, entwickeln wir Sensibilisierungsmaterial: etwa Flyer für Fachleute oder für ältere Menschen und Angehörige, aber auch Erklärvideos, die dazu anregen, Hilfe zu suchen. Zunächst geht es darum, die Denkweise der Betroffenen zu verstehen, und daraus Botschaften abzuleiten, um sie zum Nachdenken anzuregen.
Wie hängt aus Ihrer Sicht eine Stärkung der Betreuung mit Gewaltprävention zusammen?
Delphine Roulet Schwab: Da gibt es einen starken Zusammenhang. Etliche Misshandlungen werden von betreuenden Angehörigen begangen, die erschöpft, aber auch schlecht informiert sind. Eine bessere Anerkennung dieser Arbeit und eine sichere Finanzierung wären eine wichtige Unterstützung für die Angehörigen. Und es würde das Risiko von Misshandlungen reduzieren.
Der Bund prüft ein Impulsprogramm zu Gewalt im Alter, mit einem Fokus auf Betreuung im Alter. Finden Sie ein solches notwendig?
Delphine Roulet Schwab:
Das ist ein sehr wichtiges Programm. Denn es verschafft dieser Problematik die nötige Anerkennung. Das Programm sollte zwei Dinge beachten: einerseits die bestehenden Angebote und Organisationen, die zur Prävention von Misshandlung beitragen, sichtbar machen, dauerhaft sichern und den Zugang für die Betroffenen vereinfachen. Die Opfer müssen wissen, dass es dieses Angebot gibt, dass es nichts kostet und dass die Sprache kein Problem ist.
Andrerseits soll das Programm die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren stärken. Denn derzeit gibt es zwar viele Organisationen, die sich im Bereich Betreuung und Pflege älterer Menschen oder Prävention von Misshandlung engagieren, aber jede ein wenig für sich. Es gibt Netzwerke, doch niemand hat eine Gesamtübersicht. Es besteht ein echter Bedarf an Sichtbarkeit, leichtem Zugang und Koordination.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Bild von John Matychuk auf unsplash
Gewalt in der häuslichen Pflege
(k)ein Tabu-Thema
Aggressives Verhalten zwischen Pflegebedürftigen und deren pflegenden Angehörigen kommt häufig vor – von beiden Seiten. Genaue Zahlen gibt es nicht. Das liegt auch daran, weil dieses Thema in vielen Familien ein Tabu ist. Dabei wäre es besonders wichtig, offen und ehrlich darüber zu sprechen. Durch schlichte Verleugnung lässt sich Aggression im Pflegealltag nicht überwinden oder verhindern.
In der Psychologie gibt es zahlreiche Definitionen von Aggression. Ebenso zahlreich sind die Erklärungen, um aggressives Verhalten und seine Ursachen zu verstehen.
Folgen von Frustration
Wer auf seine eigenen Wünsche und Erwartungen ans Leben immer wieder verzichten muss, reagiert irgendwann mit Missmut, Unzufriedenheit und Verbitterung. Die Psychologie nennt es Frustration. Sie wird als eine wesentliche Ursache für Aggression und Gewalt gesehen – auch im Pflegealltag. Viele pflegende Angehörige sind mit der neuen Aufgabe völlig überfordert. Anfangs gleicht größter Einsatz dies noch aus, aber oft folgen später Hoffnungslosigkeit und Frustration. Solange kein Weg gefunden wird, die enorme Belastung befriedigend in den Alltag einzubauen, bleibt die Gefahr, dass die Nerven irgendwann blank liegen. Häufige Folge: Aggression und Gewalt.
Formen von Aggression
Aggressives Verhalten kann sich in unterschiedlichen Formen zeigen. Die offensichtlichste Form ist körperliche Gewalt: Schlagen, körperliche Bedrohung, Sachbeschädigung, aber auch die bewusst rohe und nachlässige Behandlung eines Pflegebedürftigen. Häufiger tritt Aggression aber in Worten und Gesten auf – Beleidigungen, Spott, Beschimpfungen, Schreien oder eine besonders unflätige Sprache.
Der Grat zwischen verbaler Aggression und körperlicher Gewalt ist schmal. Daneben gibt es noch indirekte Formen, mit denen beispielsweise Pflegebedürftige schikaniert werden. Etwa wenn das Telefon oder die Fernbedienung für den Fernseher absichtlich außerhalb ihrer Reichweite platziert werden, oder wenn es öfter Essen gibt, das sie noch nie mochten. Aggressives Verhalten im Pflegealltag ist ein Alarmsignal für Überlastung und Hilflosigkeit. Der pflegende Angehörige befindet sich meistens schon in einem ernsten Erschöpfungszustand.
Wenn es erst einmal zu Formen von Gewalt kommt, beispielsweise beim Essenreichen, weitet sich dies oft schnell auf weitere Bereiche der Betreuung aus; Grobheiten beim Ankleiden, falsche Wassertemperaturen beim Waschen der Pflegebedürftigen. Alte Menschen reagieren darauf mit den Mitteln, die ihnen noch zur Verfügung stehen. Sie schreien, schlagen um sich oder nässen vermehrt ein. Es entsteht eine verhängnisvolle Spirale: Die Überforderung des pflegenden Angehörigen wächst durch die verständliche Gegenwehr weiter – und mit ihr auch die Gewalt.
Bedürfnisse respektieren – Perspektiven wechseln
In belastenden Situationen sind wir stark mit uns selbst beschäftigt und es fällt uns schwer, uns in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Wir stehen uns quasi selbst im Weg. Dies führt häufig zu Streit. Wenn wir es schaffen, einen Schritt zurück zu gehen, können solche belastenden Situationen wieder bewältigt werden ohne sich gegenseitig zu verletzen.
Wir alle können lernen, einfühlsam auf unser Gegenüber einzugehen
- Schritt 1: Eigene Gefühle zeigen
Wir sollten unsere Gefühle nicht verstecken, sondern angemessen ausdrücken und darüber sprechen. Indem wir unsere eigenen Gefühle besser verstehen und sie mitteilen, fällt es uns auch leichter die Gefühle anderer zu verstehen.
- Schritt 2: Ein aufrichtiges Interesse für das Gegenüber entwickeln
Was hat unser Gegenüber erlebt? Wie fühlt er sich wohl gerade? Weshalb ist sie oder er glücklich, traurig, verärgert oder deprimiert?
- Schritt 3: In die Schuhe des anderen schlüpfen
Um den erkrankten Angehörigen besser zu verstehen und mit ihm zu fühlen, müssen wir uns darum bemühen die Situation aus seiner Sicht zu sehen. Indem wir für einen Moment versuchen, die Welt mit den Augen des erkrankten Angehörigen zu sehen, gehen wir innerlich einen Schritt zurück und können in belastenden Situationen gelassener reagieren.
Hierbei können folgende Fragen hilfreich sein:
Wie würde ich mich fühlen, wenn…
Was wäre mein Bedürfnis, wenn…
Was würde mir Freude machen, wenn…
Was würde mich stören oder mir Angst machen, wenn….
Angenommen ich würde so im Bett liegen und könnte nicht mehr alleine aufstehen…
Hin und wieder in die Rolle des Erkrankten zu schlüpfen, erhöht also nicht nur das Gespür für dessen Wünsche. Es hilft besonders auch, in belastenden Situationen der Pflege gelassener zu reagieren. Veränderungen in der Beziehung zwischen dem pflegenden und dem erkrankten Angehörigen werden früher bemerkt.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Foto von Ben White auf Unsplash
Schuldgefühle in der Pflege von Angehörigen – wie damit umgehen?
„Ich habe deinen Vater auch bis zum Ende gepflegt – da musste ich auf viel verzichten.“ Diesen Satz hört die 49-jährige Bürokauffrau fast jede Woche von ihrer Mutter. Ein k.o.-Argument. Sie traut sich kaum zu sagen, dass sie nicht mehr zurecht kommt mit der Doppelbelastung von Beruf und Versorgung ihrer Mutter in deren Haushalt. Ihr Hausarzt, bei dem sie in letzter Zeit immer öfter ist, hat Petra Gscheitle dringend Entlastung und eine Kur angeraten. Sie leidet unter Schlafstörungen und schleppt sich lust- und kraftlos durch den Tag. Alles ist ihr zu viel und am Arbeitsplatz macht sie Fehler.
Der richtige Umgang mit Schuldgefühlen, ihre Überwindung oder zumindest ihre Linderung lässt sich lernen.
Vielfältige Usachen für Schuldgefühle in der häuslichen Pflege
Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, berichten nicht selten von Schuldgefühlen. Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein: Manche wünschen sich nach langer Pflegezeit einfach wieder etwas mehr eigenes Leben neben der Pflegetätigkeit. Dieser Wunsch löst Schuldgefühle aus. Besonders dann, wenn der Gepflegte der Partner oder die Partnerin ist und ein aktives Leben nicht mehr wie früher gemeinsam möglich ist.
Andere pflegende Angehörige beschäftigen sich immer wieder mit der Frage, ob die von ihnen geleistete Pflege wirklich ausreicht und gut genug ist. Ursachen von Schuldgefühlen sind hier zu hohe eigene Ansprüche und die Sorge, sie nicht zu erfüllen.
Auch das Gefühl, durch den täglichen Zeitdruck nicht genug zu geben, löst Selbstvorwürfe aus. Andere plagt das schlechte Gewissen, wenn sie ihre Überforderung mit der Pflege durch Gereiztheit und Aggression an dem Pflegebedürftigen auslassen. Große Schuldgefühle verursacht oft auch die Entscheidung, einen Angehörigen im Heim pflegen zu lassen, anstatt es selbst zu tun.
Oft bewerten Betroffene ein einmaliges Fehlverhalten oder Versäumnis unangemessen hoch. Ihr Schuldgefühl bleibt nicht auf dieses einmalige Ereignis beschränkt, sondern sie werten sich dafür komplett als Person herab. Das ist besonders fatal, weil manche Menschen sich auch für Vorfälle schuldig fühlen, für die sie kaum Verantwortung tragen.
Schuldgefühle sind nicht nur nervige Gefühle. Sie können dauerhaft belasten und die Pflege-Beziehung erschweren. Werden Schuldgefühle nicht bearbeitet, können sie auf andere Menschen oder Situationen übertragen werden. Manche Menschen reagieren mit Frust und Wut, andere werden traurig und erleben depressive Verstimmungen.
Was gibt mir Kraft? Was kann ich mir Schönes tun? Wo liegt meine Grenze?
Diese subjektiven Schuldgefühle treten häufig dann auf, wenn die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Zu hohe Erwartungen fördern sie ebenfalls. Häufig kennen pflegende Angehörige ihre körperlichen, seelischen und zeitlichen Grenze nicht, und nehmen ihr Bedürfnis nach Ruhe nicht ernst. Man möchte alles richtig machen und denkt, dass man „das schon irgendwie schaffe“. Es dauert häufig lange, bis man spürt und versteht, dass das gar nicht geht und einen die Situation manchmal auch überfordert.
Betroffenen hilft of die folgende Frage: Was erwarte ich von mir und wie realistisch ist das?
Es braucht Mut und Zeit, sich mit der eigenen Rolle zu beschäftigen. Es kann sein, dass es traurig macht, weil es zwingt, sich mit der Krankheit des Angehörigen und deren weiteren Verlauf zu beschäftigen. Und es kann traurig machen, weil man realisiert, dass man sich verabschieden muss, von Hoffnungen, Erwartungen und Wünschen. Und doch ist dieser Blick wichtig, denn so kann auch Neues entstehen. Beratungsgespräche, der Austausch mit anderen Angehörigen und auch guten Freundinnen ist da Gold wert. Auch eine Therapie oder ein Coaching können helfen, die eigene Situation zu sehen und die eigene Rolle zu klären.
„Man kann nur gut pflegen, wenn es einem selbst gut geht.“ Wenn ich übermüdet, überfordert und dauernd gereizt bin, wie soll ich mich dann gut um meine Angehörigen kümmern? Ich kann Gutes tun – und dafür muss es mir gut gehen.
Eine der wichtigsten Fragen, die pflegende Angehörige sich stellen sollten, ist daher: Was gibt mir Kraft? Was kann ich mir Schönes tun? Wo liegt meine Grenze? Nein, das ist nicht egoistisch. Es ist dringend notwendig, um auf Dauer pflegen zu können. Es müssen keine großen Auszeiten sein, aber es ist wichtig, Dinge zu tun, die einen durchatmen lassen und die Anspannung lösen. Mal in Ruhe mit einer Tasse Tee am Fenster stehen und eine kleine Gedankenreise machen. Mir abends Zeit nehmen, um in einem Buch zu lesen. Und in jedem Fall hilft es, auch mal Nein zu sagen. Die eigenen Grenzen finden und sie zu wahren. Muss es immer jetzt sofort sein? Kann es jemand anders erledigen? Pflegen braucht ein Netzwerk und Flexibilität. Aufgaben und Zuständigkeiten dürfen sich verändern.
Pflegende Angehörige in der Spitex:
Chancen, Herausforderungen
Seit dem Bundesgerichtsurteil von 2019 ist es so, dass Pflegende Angehörige für Leistungen der Grundpflege von den Kranken-versicherungen bezahlt werden können – dies jedoch nur durch eine Anstellung bei einem Spitex Leistungserbringer.
Das hat den Markt wach gerüttelt. Denn seither gibt es unzählige Organisationen, deren eine Zweck es ist, Pflegende Angehörige anzustellen.
Pflegende Angehörige leisten einen unverzichtbaren Teil der Pflege. In der Schweiz gibt es rund 600’000 Pflegende Angehörige. Insgesamt 64 Millionen Stunden häuslicher Pflege und Betreuung werden durch Angehörige jährlich geleistet. Multipliziert mit den durchschnittlichen Arbeitskosten von 55.63 CHF pro Stunde entspricht dies einem Wert von 3.5 Milliarden Franken. Jedoch erhalten Pflegende Angehörige häufig keine Bezahlung und ihr Engagement bleibt gesellschaftlich und gesundheitsökonomisch weitgehend ungeachtet. Sie nehmen Lohneinbussen und Einbussungen im Rentenalter in Kauf.
Pflegende Angehörige profitieren bei einer Anstellung von der Einbettung in ein fachliches Team, von einer sozialen Absicherung, höheren Chancen auf dem Arbeitsmarkt und einer Anrechnung der Leistungen auf dem Bildungsweg in der Pflege. Wenn die zu pflegende Person die Unterstützung der Pflegenden Angehörigen nicht mehr benötigt, kann die Pflegende Angehörige weiter in der Pflege arbeiten. Diese Möglichkeit mehr Pflegefachpersonen, wenn auch mehrheitlich als Assistenzpersonal für die Pflege zu gewinnen ist wichtig.
Die Pflegenden Angehörigen erhalten einen Vertrag bei der Organisation. Lohn und Umfang bestimmt die Organisation. Abgegolten werden die Leistungen, die als grundpflegerische Leistungen definiert werden, wie beispielsweise Unterstützung bei der Körperpflege, der Mobilisation oder dem Essen eingeben. In der Regel beträgt der Lohn CHF 33.50 pro Stunde.
Wie funktioniert das Erwerbsmodell?
Mit dem Erwerbsmodell werden pflegende Angehörige in Spitex-Betrieben angestellt. Die folgende Auflistung zeigt die wichtigsten Merkmale auf, die im Manual noch detaillierter erläutert werden:
- Die pflegenden Angehörigen erhalten einen Arbeitsvertrag vom Spitex-Betrieb. Sie haben somit Rechte und Pflichten als reguläre Arbeitnehmende
- Den Umfang der Anstellung und die Lohnhöhe bestimmen der Spitex-Betrieb
- Der zeitliche Umfang einer Anstellung richtet sich nach dem Pflegebedarf für die zu pflegende Person. Die Bedarfsermittlung, die durch eine Pflegefachperson erfolgt, beruht auf den Vorgaben der Krankenpflege-Leistungsverordnung. In der Regel erwächst daraus für pflegende Angehörige ein Teilzeitpensum
- Bis anhin war für die Anstellung der Besuch eines Pflegehilfe-kurses notwendig, um den Qualifikationsanforderungen der Administrativverträge nachzukommen. Aktuell wird zwischen Spitex Verbänden und Krankenversicherungsverbänden abgeklärt, unter welchen Bedingungen eine Anstellung auch ohne Qualifikation möglich ist, denn gemäss dem Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2019 ist keine Ausbildung für Grundpflege-leistungen erforderlich.
Checkliste für pflegende Angehörige
Die folgende Checkliste soll pflegenden Angehörigen bei den Überlegungen unterstützen, was sie bei einer Anstellung bei der Spitex berücksichtigen sollten:
✓ Ich kenne das Ergebnis der Bedarfsermittlung bei der zu pflegenden Person, das als Basis für den Umfang der Anstellung gilt.
✓ Ich informiere mich über die notwendigen Ausbildungs-anforderungen (z.B. Pflegehilfekurs), welche es benötigt, deren Dauer und Kosten. Bei Bedarf wende ich mich an die Spitex.
✓ Ich überlege mir, um wie viel Prozent ich meine derzeitige Tätigkeit reduzieren kann/möchte und achte darauf, dass ich beim Erbringen von Grundpflege auf ein Arbeitspensum von maximal 12.6 Stunden (30%) komme.
✓ Wenn ich Bedenken habe, ob und wie sich eine Anstellung bei der Spitex auf meine allgemeine finanzielle Situation auswirkt, kann ich mich mithilfe des Kalkulationstools dazu informieren.
✓ Ich nehme mir regelmässig Zeit, um mich zu erholen und aufzutanken. Bei Bedarf hole ich mir Unterstützung.
✓ Ich nutze die Probezeit bewusst dazu, um die Anstellung zu beurteilen und nehme gegebenenfalls danach Anpassungen vor.
✓ Ich versuche, Berufliches und Privates so gut es geht zu trennen und berücksichtige, dass ich im Rahmen einer Anstellung das Recht auf Ruhe- und Ferientage und sonstige bezahlte und unbezahlte Abwesenheiten habe.
✓ Ich kläre mit der Spitex den Einsatz einer Pflegefachperson während der Inanspruchnahme von Ferien oder sonstigen bezahlten oder unbezahlten Abwesenheiten.
✓ Ich trage Sorge zu mir und meiner Gesundheit.
✓ Ich traue mich «Nein» zu sagen und kenne meine Grenzen.
✓ Ich kläre mit allen Beteiligten (auch mit der betreuten Person) meine Rechte und Pflichten ab. Dazu gehört auch, dass ich das Recht habe, jederzeit das Arbeitsverhältnis zu kündigen oder das Recht, mir bei Überlastung professionelle Unterstützung
seitens der Spitex zu holen (z.B. Anleitungen und Tipps zur Pflege).

Quelle: Beitrag auf zuhausealtwerden.ch (→ Link).
Bildnachweis: Bild von Christiano Pinto auf unsplash
Essen auf Rädern – Menüservice für Senioren
Weniger einkaufen, nicht mehr kochen, sondern nur noch zur Haustüre gehen, wenn der Menüservice klingelt: Das ist Essen auf Rädern.
Für viele Senioren, aber auch für pflegende Angehörige, ist Essen auf Rädern eine ideale Unterstützung im Alltag und eine hilfreiche Dienstleistung für Senioren.
Einige ausgewählten Mahlzeitendienste für Senioren
weekly-food.ch
- Frische Box mit in der Schweiz zubereiteten Mahlzeiten und Lieferung von gekochten Mahlzeiten seit 2021
==> https://weekly-food.ch/de/
eatunique.ch
- Gesunde Gerichte, von Spitzenköchen gekocht, wöchentlich zu Ihnen geliefert. ==> https://eatunique.ch/
bienbon.ch
- Die Speisekarte wechselt jede Woche. Frisch und saisonal, Sie müssen Ihre Gerichte nur noch aufwärmen. ==> https://bienbon.ch/de
Powermeals
- Frische & fix-fertige Gerichte. Wöchentliche Lieferung mit dem Essens Abo. ==> https://powermeals.ch
Casa Gusto
- Mahlzeitendienst der Pro Senectute : Lieblingsmenu bestellen und gratis liefern lassen ==> https://www.casa-gusto.ch/
Ortsansässige Restaurants
- Haben Sie ein Restaurant in Ihrer Nähe? Fragen Sie telefonisch oder per Mail nach, ob sie auch einen Lieferdienst haben.
Alters-und Pflegeheime
- Viele Alters- und Pflegeheime bieten einen Mittagstisch oder Mahlzeitendienst für Externe an.
domicilbern.ch
- Fein gekocht, persönlich geliefert, Region Bern ==> https://www.domicilbern.ch/angebot/gastronomie/mahlzeitendienst
just eat.ch
- Essen online bestellen: über 1950 Kuriere zur Auswahl ==> https://www.just-eat.ch
gourmet-domizil.ch
- Mahlzeitendienst für Privatkunden zu Hause oder im Büro, keine Liefergebühren und keine Bestellgebühren ==> https://www.gourmet-domizil.ch/
Mosi.ch
- Mosi’s liefert Essen zuverlässig in Restaurant-Qualität seit 1998 in die Regionen Zürich, Bern, Zug und Winterthur. Bestellen Sie unter ==> https://www.mosi.ch/de/
Pro Senectute
- Essen auf Rädern: Mahlzeitendienst liefert Ihnen mehrmals wöchentlich eine feine Mahlzeit nach Hause ==> https://www.prosenectute.ch/de/dienstleistungen/hilfen/hilfen-zu-hause.html
Spitex
- Verschiedene Spitex-Organisation bieten in ihrer Region zusätzlich einen Mahlzeitendienst an. ==> www.spitex.ch
TCS Test:
Elektro-Seniorenmobile auf dem Prüfstand
Für ältere Menschen, die Mühe haben längere Strecken zu gehen oder sonst in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen sind sogenannte elektrische Seniorenmobile ein ideales Mittel,
um die persönliche Bewegungsfreiheit beibehalten zu können. Die kleinen Elektromobile erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, das Angebot wird immer grösser.
Der TCS hat sieben in der Schweiz vielverkaufte Seniorenmobile auf Herz und Nieren geprüft
Für die Auswahl der sieben Testfahrzeuge wurden die relevantesten Produkte auf dem Markt anhand verschiedener Kriterien identifiziert. Folgende Mobile wurden getestet.
Marke / Modell
- Luxxon E3800
- Graf Carello, GC9
- Kyburz, DX2
- Easyrider Jet 304X
- Mobil Comfort HS-898
- Steck Mobil Luxor
- Elektromobil Go
Wie wurde getestet?
Die Elektromobile wurden von den TCS Experten bezüglich der Kriterien Antriebssystem, Sicherheit, Qualität und Service getestet und beurteilt.
- In der Kategorie Antriebsystem wurden die Reichweite, der Energieverbrauch pro Kilometer, der maximale Anfahrwinkel und die Belastungsresistenz überprüft.
- In die Kategorie Sicherheit flossen die Parameter Beleuchtung, Bremsen, der seitliche Kippwinkel, das Vorhandensein einer automatischen Feststellbremse, einer Geschwindigkeitsbegrenzung bergab sowie in Kurven mit ein.
- In die Kategorie Qualität wurden die Elektrik, Sitz und Karosserie, der Wendekreis, das Fahrwerk, die Räder und Reifen, die Fahrbarkeit bei Regen und die Qualität der Ladegeräte getestet.
- In die Kategorie Service flossen die Parameter Reparatur von Batterie und Pneu, der Abholdienst, die Anzahl Service Stellen, die Garantie auf Fahrzeug und Batterie, die Ersatzteilverfügbarkeit, das Vorhandensein eines Pannendienstes und die Verfügbarkeit von Ersatzfahrzeugen ein.
- Weiter wurden die Fahrzeuge auch in einem Praxistest von Senioren und körperlich eingeschränkten Personen gefahren und in den Kategorien Komfort und Fahreigenschaften bewertet. Damit konnten sowohl messbare Parameter als auch subjektive Bewertungen in die Gesamtbewertung einfliessen und ein umfassendes Bild der einzelnen Produkte erreicht werden.
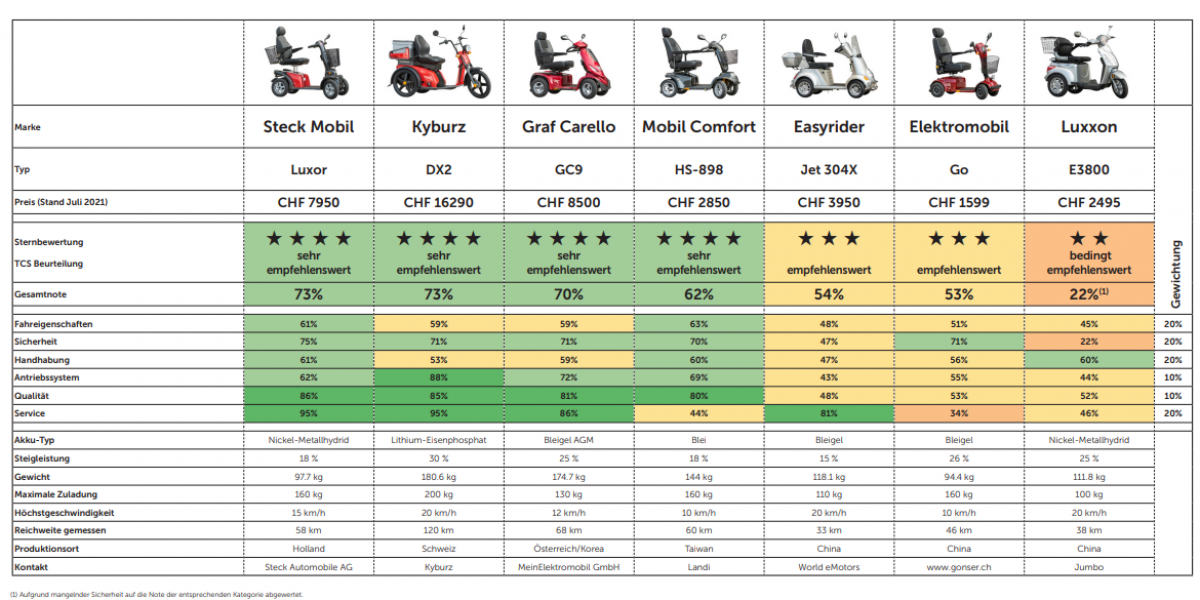

Quelle: Beitrag auf www.curaviva.ch (-> Link)
Bildnachweis: Bild von Carola68 Die Welt ist bunt…… auf Pixabay
Wenn bei Demenz der Übertritt in eine Pflegeeinrichtung notwendig wird
Bei allem Bemühen, an Demenz erkrankten Angehörigen so lange wie möglich das vertraute Zuhause zu bewahren, kommen Angehörige und Pflegende irgendwann an den Punkt, an dem sich ein Übertritt in eine Pflegeeinrichtung nicht mehr vermeiden lässt – im Interesse der Betroffenen und der Angehörigen.
Wir zeigen auf, was in dieser schwierigen Phase zu beachten ist.
Kann ich für meinen demenzkranken Angehörigen über den Heimeintritt entscheiden?
Diese Frage stellt sich angesichts der emotionalen und körperlichen Belastung, zu der es für Angehörige kommt, wenn sie eine demenzkranke Person betreuen. Die Belastung nimmt mit dem Fortschritt der Krankheit zu. Es ist deshalb wichtig, sich Hilfe zu holen, bevor man der Aufgabe nicht mehr gewachsen ist. Es gibt verschiedenste Unterstützungsangebote zur Entlastung der Angehörigen, zum Beispiel von den kantonalen Sektionen der Schweizerischen Alzheimervereinigung und den öffentlichen sowie privaten Spitex-Diensten.
Wann schliesslich ein Heimeintritt angezeigt ist, hängt vor der individuellen Situation ab. Die Alzheimervereinigung empfiehlt ihn, wenn die Betreuung zu Hause nicht mehr möglich ist, weil sie zum Beispiel rund um die Uhr erbracht werden müsste, oder wenn die betreute Person sich selbst oder andere gefährdet. In der Broschüre «Den Heimeintritt ins Auge fassen» sind weitere Kriterien aufgeführt.
Rechtlich gesehen, verlieren Menschen mit Demenz im Verlauf der Krankheit ihre Urteilsfähigkeit. Gemäss Gesetz können vertretungsberechtigte Personen, welche die Interessen der urteilsunfähigen Person im medizinisch-pflegerischen Bereich wahrnehmen, mit einem Heim einen Betreuungsvertrag abschliessen. In diesem Vertrag werden die Leistungen der Institution und das Entgelt festgehalten. Was aber, wenn die von Demenz betroffene Person den Heimeintritt verweigert? In diesem Fall kommt die Fürsorgerische Unterbringung als eine behördliche Massnahme zum Tragen. Diese Massnahme kann von der Erwachsenenschutzbehörde KESB angeordnet werden, sofern die Behandlung oder Betreuung nicht anderweitig möglich ist. Dies ist etwa der Fall, wenn sich die Person ernsthaft selbst gefährdet oder Unterstützungsangebote wie Spitex oder Mahlzeitendienst nicht mehr genügen.
Das A und O ist die rechtzeitige Vorsorge für den Fall von Urteilsunfähigkeit. Demenzkranke Menschen sollten sich frühzeitig, das heisst bei noch vorhandener Urteilsfähigkeit, zusammen mit ihren Angehörigen überlegen, wie die persönlichen und finanziellen Angelegenheiten geregelt werden und wer später einmal für sie entscheiden und handeln kann, sollte eine Urteilsunfähigkeit eintreten. Das Erwachsenenschutzrecht sieht dabei neu den Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung als Instrumente vor, mit denen man seinem Willen Ausdruck verleihen kann. Auch pflegende Angehörige sollten früh genug Wünsche und Bedürfnisse im Krankheitsfall ansprechen, damit genug Zeit und Energie bleibt, um für alle Beteiligten eine möglichst gute Lösung zu finden. Ein wichtiger Grund für die rechtzeitige Vorsorge ist zudem die Tatsache, dass ein Heimeintritt mit Wartezeiten verbunden sein kann. Und gerade nach einem Spitalaufenthalt kann ein Heimeintritt sehr plötzlich anstehen.
Was braucht es, damit ich Entscheidungen für meine Angehörige:n im Alters- oder Pflegeheim treffen kann?
Damit eine Person stellvertretend für jemand anderen Entscheidungen treffen kann, muss entweder eine Vollmacht erteilt worden sein, oder es müssen eine Urteilsunfähigkeit sowie eine Vertretungsberechtigung vorliegen. Die Vertretung wird gemäss persönlicher Verfügung, Gesetz oder behördlicher Anordnung geregelt. Beim Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim werden die konkreten Vertretungsverhältnisse genau eruiert und dokumentiert.
Mit einer Vollmacht wird bereits vor dem Eintritt einer allfälligen Urteilsunfähigkeit eine vertretungsberechtigte Person bestimmt, die bestimmte Angelegenheiten erledigen darf. Umstritten ist, ob die Vollmacht auch nach dem Eintritt der Urteilsunfähigkeit gültig bleibt. Auf jeden Fall ist sie rechtlich weniger verbindlich als ein Vorsorgeauftrag oder eine Patientenverfügung. So belässt die Vollmacht im Fall einer Urteilsunfähigkeit den Erwachsenenschutzbehörden (KESB) grössere Freiheiten, andere nahestehende Personen zu befragen oder als Vertreter einzusetzen. Auch das Pflegepersonal ist freier, andere Personen als der/die Bevollmächtigte über den mutmasslichen Willen der urteilsunfähigen Person zu befragen, als wenn ein Vorsorgeauftrag oder eine Patientenverfügung vorliegt.
Liegt eine Urteilsunfähigkeit vor, sind zunächst jene Personen vertretungsberechtigt, die durch einen Vorsorgeauftrag oder eine Patientenverfügung (diese betrifft medizinische Massnahmen) für die Vertretung in bestimmten Angelegenheiten vorgesehen sind. Der Vorsorgeauftrag kann dabei die Vertretung in verschiedenen Lebensbereichen – Vermögen, Rechtsverkehr, Personensorge – regeln. Tritt die Urteilsunfähigkeit ein, prüft die Erwachsenenschutz-behörde die Gültigkeit des Vorsorgeauftrags und erstellt ein entsprechendes Aufgabenheft für den/die Vertretungsberechtigte:n. Wer spezifisch für medizinisch-pflegerische Angelegenheiten vertretungsberechtigt ist, können sowohl der Vorsorgeauftrag als auch die Patientenverfügung festlegen. Die Patientenverfügung kann zusätzlich konkrete Wünschen zu Behandlung und Pflege festhalten.
Fehlen solche persönlichen Verfügungen, sieht das Gesetz die folgende Vertretungsreihenfolge vor:
- In medizinischpflegerischen Angelegenheiten ist zunächst der/die Ehepartner:in oder der/die eingetragene Partner:in vertretungsberechtigt, falls ein gemeinsamer Haushalt besteht oder er/sie der urteilsunfähigen Person regelmässig persönlichen Beistand leistet. Danach folgen der Reihe nach: die Person, mit der die urteilsunfähige Person einen gemeinsamen Haushalt führt; ihre Nachkommen, Eltern sowie Geschwister – allerdings nur, falls diese der urteilsunfähigen Person regelmässig persönlichen Beistand leisten.
- In Alltagsgeschäften, der Vermögens- und Einkommensverwal-tung sowie beim Öffnen und Erledigen der Post vertretungs-berechtigt ist – ohne Vollmacht oder Vorsorgeauftrag oder Beistandschaft – einzig der/die Ehepartner:in bzw. der/die eingetragene Partner:in. Auch hier gilt diese Berechtigung nur, falls er/sie mit der urteilsunfähigen Person einen gemeinsamen Haushalt führt oder ihr regelmässig persönlichen Beistand leistet.
Schliesslich gibt es das Szenario, dass keine persönlichen Verfügungen und auch keine Personen vorhanden sind, welche die Vertretung gemäss gesetzlicher Kaskade übernehmen können. In diesem Fall errichtet die KESB eine sogenannte Beistandschaft.

Quelle: Eidgenössisches Departement des Innern EDI | Bundesamt für Gesundheit (-> Link)
Bildnachweis: Foto von Olga Kononenko auf Unsplash
Palliative Care:
Betreuung und Behandlung von Menschen
am Lebensende
Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohenden und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. Palliative Care wird vorausschauend mit-einbezogen, ihr Schwerpunkt liegt aber in der Zeit, in der die Heilung der Krankheit als nicht mehr möglich erachtet wird und kein primäres Ziel mehr darstellt.
In Anlehnung an internationale Standards wird nach Angeboten der allgemeinen und der spezialisierten Palliative Care unterschieden.
Bei der allgemeinen Palliative Care stehen Patientinnen und Patienten im Fokus, die sich aufgrund des Verlaufs ihrer unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Erkrankung mit dem Lebensende vorausschauend auseinandersetzen oder sich in der letzten Phase des Lebens befinden. Aufgrund der demografischen Entwicklung handelt es sich dabei heute mehrheitlich um (hoch-)betagte Menschen, die zu Hause oder in einem Pflegeheim leben. Leistungen der allgemeinen Palliative Care werden daher in erster Linie von Hausärztinnen und Hausärzten, Spitex-Organisationen sowie in Pflegeheimen und Akutspitälern erbracht.
Die Angebote der spezialisierten Palliative Care richten sich an Patientinnen und Patienten, die eine instabile Krankheitssituation aufweisen und eine komplexe Behandlung und/oder die Stabilisierung von bestehenden Symptomen benötigen oder bei deren Angehörigen die Überschreitung der Belastungsgrenze erkennbar wird.
Zusätzlich gibt es den Querschnittsbereich der «fach- und gruppenbezogenen Palliative Care». Er trägt dem Umstand Rechnung, dass Patientinnen und Patienten in palliativen Situationen bei bestimmten Erkrankungen fachbezogene Probleme bzw. Bedürfnisse aufweisen
(z. B. bei onkologischen oder neuro-degenerativen Erkrankungen, Nierenkrankheiten, psychiatrischen oder Suchterkrankungen). Zudem gibt es Bevölkerungsgruppen wie besonders junge oder alte Menschen (Pädiatrie, Geriatrie), Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung oder in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Menschen mit einer erschwerten Fluchtgeschichte oder mit einem niedrigen sozioökonomischen Status), die besondere Bedürfnisse aufweisen, die es zu berücksichtigen gilt.
Allgemeine Palliative Care
Patientinnen und Patienten in der allgemeinen Palliative Care sind Personen, die sich aufgrund des Verlaufs ihrer unheilbaren, lebensbedrohenden und/oder chronisch fortschreitenden Erkrankung vorausschauend mit dem Lebensende auseinandersetzen oder sich in der letzten Phase des Lebensbefinden. Aufgrund der demografischen Entwicklung handelt es sich dabei derzeit mehrheitlich um (hoch-)betagte Menschen, die zu Hause oder in einem Pflegeheim leben. Allgemeine Palliative Care beginnt deshalb früh-
zeitig im Verlauf einer unheilbaren Krankheit bzw. altersbedingter Gebrechlichkeit
Spezialisierte Palliative Care
Unter dieser zahlenmässig kleineren Patientengruppe versteht man Patientinnen und Patienten, die eine instabile Krankheitssituation aufweisen und daher eine komplexe Behandlung und/oder die Stabilisierung von bestehenden Symptomen benötigen oder bei deren Angehörigen die Überschreitung der Belastungsgrenze erkennbar wird. Sie sind daher auf die Unterstützung durch spezialisierte Palliative Care angewiesen (mobiler Palliativdienst, Palliativstation, spezialisierte Palliative Care in der Langzeit-
pflege).
Mobiler Palliativdienst
Mobile Palliativdienste unterstützen die Leistungserbringer der Grundversorgung mit spezialisiertem Palliative-Care-Fachwissen. Ziel ist es, dass Patientinnen und Patienten, die eine instabile Krankheitssituation aufweisen und/oder (phasenweise) eine komplexe Behandlung bzw. die Stabilisierung von bestehenden Symptomen benötigen, an ihrem jeweiligen Aufenthaltsort (Akutspital, Langzeitbereich, zu Hause) Zugang zu spezialisierter Palliative Care erhalten
Palliativstation
Eine Palliativstation ist eine Abteilung in einem Akutspital. Hier werden Patientinnen und Patienten behandelt und betreut, die spezialisierte Palliative Care benötigen (s. oben). Entscheidend für die Aufnahme ist dabei – wie im stationären Akutbereich – die Spitalbedürftigkeit.
Stationäre Hospizstrukturen
Stationäre Hospizstrukturen bieten spezialisierte Palliative-Care-Leistungen für Patientinnen und Patienten an, deren Krankheitssituation mehrheitlich stabil ist, deren Behandlung aber hochgradig komplex ist und daher stationär erfolgt.15 Hospizstrukturen werden heute entweder als eigenständige Einrichtungen der Langzeitpflege (Hospize) oder als Stationen und Abteilungen einer Einrichtung der Langzeitpflege (Pflegeheim) angeboten.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Bild von Filmbetrachter auf Pixabay
Sozialversicherungen und Hilfsmittel:
was wird gezahlt ?
Sollten Sie Bedarf an Hilfsmitteln haben, gibt es von AHV bis IV Möglichkeiten Unterstützung zu erhalten.
In unserem Beitrag finden Sie eine Übersicht dieser Sozialversicherungen und Anspruchsgrundlagen.
Gesetzliche Krankenversicherung (KVG)
Die Versicherung leistet eine Vergütung an Mittel und Gegenstände, die der Behandlung oder der Untersuchung im Sinne einer Überwachung der Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen. Diese werden auf ärztliche Anordnung abgegeben und von der versicherten Person selbst oder mit Hilfe einer nichtberuflich an der Untersuchung oder der Behandlung mitwirkenden Person angewendet.
Die Mittel und Gegenstände werden höchstens zu dem Betrag vergütet, der in der Liste für die entsprechende Art von Mitteln und Gegenständen angegeben ist. Liegt für ein Produkt der von der Abgabestelle in Rechnung gestellte Betrag über dem in der Liste angegebenen Betrag, so geht die Differenz zu Lasten der versicherten Person. Kostspielige und durch andere Patienten und Patientinnen wieder verwendbare Mittel und Gegenstände werden in der Regel in Miete abgegeben.
Relevante Gesetzesartikel: Art. 20ff. KLV, Art. 55 KVV, Mittel- und Gegenstände-Liste (MiGeL)
Die Liste der Mittel und Gegenstände wird auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) publiziert: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
Invalidenversicherung (IV)
Versicherte der IV haben im Rahmen Anspruch auf Hilfsmittel, die sie benötigen, um weiter erwerbstätig oder in ihrem bisherigen Aufgabenbereich (z. B. als Hausfrau oder Hausmann) tätig bleiben zu können, aber auch auf Hilfsmittel, die für die Schulung, Ausbildung und funktionelle Angewöhnung benötigt werden.
Anderseits haben Versicherte der IV auch Anspruch auf Hilfsmittel, die sie brauchen, um ihren privaten Alltag möglichst selbständig und unabhängig zu bewältigen. Dazu gehören Hilfsmittel für die Fortbewegung, für die Herstellung von Kontakten mit der Umwelt und für die Selbstsorge.
Relevante Gesetzesartikel: Art. 21ff. IVG, Art. 1ff. HVI, Art. 43ter AHVG, HVA
https://www.ahv-iv.ch/p/4.03.d
Für die erstmalige Anmeldung Ihres Anspruchs müssen Sie das Formular «001.002 – Anmeldung für Erwachsene: Hilfsmittel» bei der IV-Stelle Ihres Wohnsitzkantons einreichen (Link siehe unten). Die IV-Stelle prüft, ob nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Anspruch besteht.
https://finfo.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=IV&form=001_002_v1&lang=de
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)
BezügerInnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz in der Schweiz können den Anspruch auf Hilfsmittel bei der IV-Stelle des Wohnsitzkantons anmelden. Welche Hilfsmittel werden vergütet?
Die AHV übernimmt nach Prüfung des Anspruchs durch die IV-Stelle ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen in der Regel die Kosten für die Hilfsmittel, die im Folgenden aufgeführt sind.
https://www.ahv-iv.ch/p/3.02.d
https://www.ahv-iv.ch/p/3.07.d
Die Adresse Ihrer IV-Stelle finden Sie im Internet unter www.ahv-iv.ch. Haben Sie vor Erreichen des AHV-Rentenalters Hilfsmittel der IV oder einen Kostenbeitrag zu deren Anschaffung erhalten, so haben Sie nach Erreichen des AHV-Rentenalters weiterhin Anspruch auf diese Leistungen, solange die Voraussetzungen erfüllt sind. Im Rahmen der Ergänzungsleistungen können weitere Hilfsmittel sowie gewisse Pflege- und Behandlungsgeräte finanziert oder leihweise abgegeben werden.
Relevante Gesetzesartikel: Art. 43quarter AHVG, Art. 66ter AHVV, Art. 67 Abs. 1ter AHVV, Art. 1. – Art. 9 HVA
Unfallversicherung (UVG)
Der Versicherte hat Anspruch auf Hilfsmittel, soweit diese durch Unfall oder Berufskrankheit bedingte körperliche Schädigungen oder Funktionsausfälle ausgleichen. Der Anspruch erstreckt sich auf die notwendigen und dem Gesundheitsschaden angepassten Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung, das erforderliche Zubehör und die Anpassungen, die wegen des Gesundheitsschadens nötig sind. Kostspielige Hilfsmittel, die ihrer Art nach auch für andere Versicherte Verwendung finden können, werden leihweise abgegeben. Alle übrigen Hilfsmittel erhält der Versicherte zu Eigentum.
Übersicht Hilfsmittel:
Prothesen
Stütz- und Führungsapparate für Gliedmassen
Orthopädische Stützkorsetts
Orthopädisches Schuhwerk
Hilfsmittel für Defekte im Kopfbereich
Hörapparate
Brillen
Sprechhilfegeräte
Fahrstühle
Hilfsmittel für Blinde und hochgradig Sehschwache
Gehhilfen
Anmerkung: Ist die Unfallversicherung für ein Hilfsmittel leistungspflichtig, so entfällt ein entsprechender Anspruch gegenüber der Invalidenversicherung.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1227_1227_1227/de#app1ahref0
Relevante Gesetzesartikel: Art. 11 UVG, Art. 19 UVV, HVUV
Militärversicherung (MV)
Der über die Militärversicherung Versicherte hat Anspruch auf Hilfsmittel für:
a. die Verbesserung seines Gesundheitszustandes;
b. die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder für die Tätigkeit in seinem Aufgabenbereich;
c. die Schulung und Ausbildung;
d. die funktionelle Angewöhnung;
e. die Fortbewegung;
f. die Selbstsorge;
g. den Kontakt mit der Umwelt.
Die Hilfsmittel werden zu Eigentum oder leihweise in einfacher und zweckmässiger Ausführung abgegeben. Die Militärversicherung verfügt über kein Hilfsmittelverzeichnis. Sind statt Hilfsmittel Dienstleistungen Dritter nötig, so gewährt die Militärversicherung Beiträge.
Relevanter Gesetzesartikel: Art. 21 MVG

Quelle: Beitrag auf ahv-iv-ch (→ Link).
Bildnachweis: Foto von Roi Dimor auf Unsplash
Wann besteht Anspruch auf Hilflosenentschädigung?
Die Hilflosenentschädigung soll Menschen mit einer Behinderung eine unabhängige Lebensführung ermöglichen. Sie deckt die Kosten von versicherten Personen, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung für alltägliche Lebensverrichtungen bzw. um soziale Kontakte zu pflegen, die Hilfe Dritter benötigen oder auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Die Höhe der Leistung hängt vom Grad der Hilflosigkeit und davon ab, ob die versicherte Person in einem Heim oder zu Hause wohnt.
Wann gilt eine Person als hilflos?
Eine Person gilt als hilflos, wenn sie wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen (Ankleiden, Auskleiden, Aufstehen, Absitzen, Essen usw.) dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf.
Als hilflos gelten auch volljährige Versicherte, die zu Hause leben und dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Das heisst, die Person ist aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung
• nicht in der Lage, ohne die Begleitung einer Drittperson selbständig zu wohnen
• für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf die Begleitung einer Drittperson angewiesen, oder
• ernsthaft gefährdet, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren.
Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss in diesen Fällen für die Annahme einer Hilflosigkeit ein Anspruch auf eine Rente gegeben sein.
Versicherte mit einer schweren Sinnesschädigung können auch Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben.
Wann habe ich Anspruch auf
eine Hilflosenentschädigung?
Sie müssen folgende Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Hilflosenentschä-digung erfüllen:
• Sie sind versichert und haben Ihren Wohnsitz in der Schweiz
• Sie haben eine schwere, mittelschwere oder leichte Hilflosigkeit
• Sie haben keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der obligatorischen Unfallversicherung oder der Militärversiche-rung
Wann beginnt und endet der Anspruch?
Der Anspruch auf eine Hilflosenentschä-digung entsteht frühestens nach Ablauf der einjährigen Wartezeit.
Der Anspruch erlischt, wenn Sie die Voraus-setzungen nicht mehr erfüllen.
Beziehen Sie vorzeitig eine AHV-Altersrente oder haben Sie das ordentliche Rentenalter erreicht, erlischt der Anspruch auf die Hilflosenentschädigung der IV. Eine Hilflosen-entschädigung mindestens in gleicher Höhe wird Ihnen von der AHV ausgerichtet, sofern die Hilflosigkeit weiterbesteht. Der Anspruch erlischt ebenfalls mit dem Tod des Berechtigten.
Wie hoch ist die Hilflosen-entschädigung?
Die monatliche Hilflosenentschädigung ist unterschiedlich hoch, je nachdem, ob Sie im Heim (mehr als 15 Tage pro Monat) oder im eigenen Zuhause wohnen:
Hilflosigkeit im Heim
– leichten Grades 123 CHF pro Monat
– mittleren Grades 306 CHF pro Monat
– schweren Grades 490 CHF pro Monat
Hilflosigkeit im eigenen Zuhause
– leichten Grades 490 CHF pro Monat
– mittleren Grades 1.225 CHF pro Monat
– schweren Grades 1.960 CHF pro Monat
Die Hilflosenentschädigung ist von Ihrem Einkommen und Vermögen unabhängig.
Beim Bezug einer Rente der AHV wird eine Hilflosenentschädigung der AHV mindestens im bisherigen Betrag weitergewährt (Besitzstand).

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Bild von Gregory Akinlotan auf Pixabay
Pflege von Multiple Sklerose Erkrankten
Bei der Pflege von Menschen mit Multipler Sklerose soll deren Selbstständigkeit so weit wie möglich gefördert und erhalten werden. Pflegeleistungen bei MS orientieren sich optimal auch immer am Ausprägungsgrad der Erkrankung. Bei zunehmender Progredienz ist jedoch eine professionelle Pflegedienstleistung unerlässlich, nicht nur, um die Angehörigen zu entlasten. Aktivierende Pflege bei Multipler Sklerose vermittelt den Betroffenen auch Hilfe zur Selbsthilfe.
Als „Krankheit mit den 1000 Gesichtern“ stellt die Multiple Sklerose auch für Angehörige und Pflegepersonal eine echte Herausforderung dar. Während beispielsweise auftretende Spastiken ein spezielles Bewegungstraining erforderlich machen, sind bei Ataxie oder Zittern ganz andere Maßnahmen in Form von Ergotherapie oder der Gabe spezieller Medikamente einzuleiten. Außerdem darf die psychische Komponente bei allen Verlaufsformen von Multipler Sklerose nie außer acht gelassen werden. Wird der tägliche Pflegealltag geplant, so sollte stets genügend Freiraum auch für unvorhergesehene Ereignisse mit eingeplant werden. Denn schnell kann sich ein bestimmtes Symptom verschlechtern oder es können an kritischen Tagen vermehrt Schmerzen auftreten. Stress, Zeitdruck, Ängste und Anspannung jeder Art führen über kurz oder lang zu einer Verschlimmerung des Krankheitsbildes oder dazu, dass bisher unbekannte Symptome auftreten. Deshalb ist die Pflege von Multiple Sklerose Kranken mit einer ganz besonderen Sensibilität, viel Einfühlungsvermögen aber auch therapeutischen Weitblick für die spezifischen Bedürfnisse der Betroffenen zu gestalten.
Oft unvorhergesehener Krankheitsverlauf erfordert spezielle Pflegemaßnahmen
Der Krankheitsverlauf ist recht individuell und kann auch bei chronischem Verlauf nicht immer vorhergesagt werden. Spontane Verbesserungen sind ebenso möglich wie rapide Verschlechterungen des Gesundheitszustandes. Darauf muss und soll Pflege adäquat reagieren. Die Körperpflege kann in vielen Fällen von den Betroffenen noch selbst durchgeführt werden. Pflegekräfte wirken dabei jedoch stets unterstützend mit. Sollten die motorischen Fähigkeiten des Patienten nicht für die Körperpflege ausreichen, so kann diese selbstverständlich auch komplett von der Pflegekraft übernommen werden. Im Krankheitsverlauf treten häufig Blasenstörungen auf. Eine sogenannte spastische Blase oder der unvermittelt auftretende Drang, auf Toilette zu müssen ist ein Szenario, auf das sich Angehörige und Pflegekräfte immer einstellen müssen. Sobald die Blasenfunktion nachhaltig gestört ist, empfinden die Betroffenen nicht selten Scham oder ziehen sich völlig in die Isolation zurück. Bei Inkontinenz kommt es also nicht nur auf die korrekte Intimhygiene oder eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr tagsüber an, sondern auch auf behutsame, psychische Begleitung.
MS Patienten benötigen eine herausragende psychische Unterstützung
Darmstörungen wie Verstopfung treten bei MS Patienten ebenfalls überdurchschnittlich häufig auf. Speisen, welche ein Völlegefühl oder Blähungen verursachen, sollten dabei vermieden werden. Patienten mit Multipler Sklerose sind aufgrund des langwierigen Krankheitsverlaufes mit unterschiedlichsten Symptomen nicht selten körperlich und psychisch erschöpft. Oft sprechen die Betroffenen nicht so gerne darüber, um ihre Angehörigen nicht zusätzlich zu belasten. Die eingeschränkte Belastbarkeit führt jedoch schnell an persönliche Grenzen. Professionelle Pflegekonzepte können dieser sogenannten Fatigue Symptomatik jedoch entgegenwirken. Dabei gilt es, dass Betroffene jede Art von negativem Stress so gut es geht vermeiden, sich unter Anleitung und so weit wie möglich ausreichend bewegen und Erholungsphasen in den Alltag einplanen. Außerdem haben sich kühle Bäder als wirkungsvoll gegen chronische Erschöpfung bei Patienten mit Multipler Sklerose bewährt. Bei Multipler Sklerose ist es also für eine professionelle Pflege ganz entscheidend, auf einzelne spezifische Symptomfelder adäquat und rasch zu reagieren.
Pflegerinnen aus Osteuropa in der rechtlichen Grauzone
Immer öfter werden private Pflegerinnen aus meist osteuropäischen Ländern engagiert. Von 30’000 sogenannten Care-Migrantinnen ist die Rede, die in der Schweiz betagte Menschen betreuen, pflegen, für sie einkaufen, waschen, bügeln und putzen. Die allermeisten von ihnen kommen aus Osteuropa. Genaue Zahlen gibt es aber nicht. In einer neuen Studie spricht das Schweizerische Gesundheitsobser-vatorium Obsan von einem «statistischen Niemandsland».
Wer sich nicht strafbar machen will, sollte die rechtlichen Aspekte des Engagements einer Care-Migrantin nicht ausser Acht lassen.
Agenturen operieren in der rechtlichen Grauzone
Auch zahlreiche Agenturen in der Schweiz und im Ausland haben das Geschäft mit den Care-Migrantinnen längst entdeckt. Sie vermitteln Pflegerinnen, die bei einer Firma in ihrem Heimatland unter Vertrag stehen, oder die sich in ihrer Heimat als selbständig erwerbend angemeldet haben.
Im Rahmen der Personenfreizügigkeit kommen die Care-Migrantinnen für 90 Tage in die Schweiz und werden dann abgelöst. Neben seriösen Anbietern gibt es auch Agenturen, die die Bestimmungen wie zum Beispiel die Mindestlöhne nicht einhalten. Bereits für unter 2’000 Franken pro Monat plus Kost und Logis arbeiten die Pflegerinnen vielfach rund um die Uhr. Werden diese Bedingungen aufgedeckt und als illegal eingestuft, muss nicht nur die Agentur, sondern auch der Auftraggeber bzw. die Auftraggeberin die rechtlichen Konsequenzen tragen. Die Obsan-Studie hat aber auch zu Tage gefördert, dass die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen kompliziert sind und teilweise Lücken und Grauzonen aufweisen.
Illegale Tätigkeit
Dies hat viel mit den Umständen zu tun, unter denen viele Care-Migrantinnen in die Schweiz kommen. Oft stellt eine betroffene Familie eine ausländische Pflegerin ein, die ihnen empfohlen wird. Sie reist mit einem Touristenvisum ein, erhält keinen Arbeitsvertrag, wird bei den Behörden nicht gemeldet und ist weder versichert noch zahlt sie Steuern. Gegen schlechte Arbeitsbedingungen kann sich die Migrantin kaum wehren, weil sie einerseits das Geld benötigt und andererseits weiss, dass sie in dieser Form einer illegalen Tätigkeit – nämlich Schwarzarbeit – nachgeht.
Familien, die eine Pflege- oder Betreuungsperson aus dem Ausland engagieren wollen, hilft ein Rechtsgutachten weiter, welches die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie allfällige bestehende Grauzonen der Gesetzgebung detailliert dokumentiert.

Quelle: Beitrag auf comparis.ch (→ Link).
Bildnachweis: Bild von Claudio Schwarz auf unsplash
Die Pflege im Alter ist in der Schweiz teuer. Was kostet die Pflege und wer bezahlt ?
Laut dem Bundesamt für Statistik lebten im Jahr 2017 insgesamt rund 153 000 Menschen in der Schweiz in Alters- und Pflege-heimen, und mehr als 350 000 Personen wurden zu Hause gepflegt.
Professionelle Pflege ist teuer. Monatlich können Kosten von bis zu 8’000 Franken entstehen. Diese werden zu unterschiedlichen Teilen von der Krankenkasse, den Patienten selber und der öffentlichen Hand finanziert.
Wer finanziert die Pflegekosten im Heim?
Die Kosten der stationären Pflege werden von der Krankenkasse, dem/der Heimbewohner/in und der öffentlichen Hand bezahlt. Die Pflegebedürftigen müssen dabei jedoch tiefer in die Tasche greifen. Wie im ambulanten Bereich gehen die Kosten für nicht-pflegerische Leistungen für Hotellerie (Zimmer, Verpflegung, Wäsche etc.) ebenfalls voll zu Lasten der Bewohner.
Was zahlt die Krankenkasse an die stationären Pflegekosten?
| Pflegestufe | Pflegebedarf | Kostenübernahme* (CHF/h) |
|---|---|---|
| 1 | bis 20 Min. | CHF 9.60 |
| 2 | von 21 bis 40 Min. | CHF 19.20 |
| 3 | von 41 bis 60 Min. | CHF 28.80 |
| 4 | von 61 bis 80 Min. | CHF 38.40 |
| 5 | von 81 bis 100 Min. | CHF 48 |
| 6 | von 101 bis 120 Min. | CHF 57.60 |
| 7 | von 121 bis 140 Min. | CHF 67.20 |
| 8 | von 141 bis 160 Min. | CHF 76.80 |
| 9 | von 161 bis 180 Min. | CHF 86.40 |
| 10 | von 181 bis 200 Min. | CHF 96 |
| 11 | von 201 bis 220 Min. | CHF 105.60 |
| 12 | mehr als 220 Min. | CHF 115.20 |
Was zahlt der/die Heimbewohner/in?
Heimbewohner/innen zahlen neben der Franchise und dem Selbstbehalt eine kantonal unterschiedliche Patientenbeteiligung, die aber maximal 21.60 Franken pro Tag beträgt.
Wer übernimmt die Restkosten der stationären Pflege?
Die übrigen Kosten, welche nicht von der Krankenkasse oder von dem/der Heimbewohner/in getragen werden, trägt die öffentliche Hand (Kantone bzw. Gemeinden).
Wer finanziert die Pflege zu Hause?
Bei ambulanten Pflegedienstleistungen durch Fachpersonen (z.B. Spitex) zahlen Pflegebedürftige deutlich weniger als bei der stationären Pflege. Die Kosten für ärztlich verschriebene Pflege zu Hause werden zu folgenden Anteilen von der Krankenkasse, den Spitex-Kunden und der öffentlichen Hand bezahlt.
Was zahlt die Krankenkasse an die ambulanten Pflegekosten?
| Leistungen | Kostenübernahme* (CHF/h) |
|---|---|
| Grundpflege (Essen und Trinken, Waschen, Anziehen, Mobilisieren etc.) | 52.60 |
| Untersuchung und Behandlung (Medikamentenabgabe, Wundversorgung, Blutdruckmessung etc.) | 63.00 |
| Abklärung und Beratung (Pflegeplanung, Anleitung bei Medikamenteneinnahme etc.) | 76.90 |
Was zahlen Kunden der Spitex?
Patienten zahlen neben der Franchise und dem Selbstbehalt eine kantonal unterschiedliche Patientenbeteiligung, die aber maximal 15.35 Franken pro Tag beträgt. Die maximal jährlich anfallenden Kosten für ambulante Pflege können im Pflegekostenrechner berechnet werden.
Wer übernimmt die Restkosten der ambulanten Pflege?
Die übrigen Kosten, welche nicht von der Krankenkasse oder den Kunden der Spitex getragen werden, übernimmt die öffentliche Hand (Kantone bzw. Gemeinden).
Voraussetzung für eine finanzielle Unterstützung durch die Krankenkasse und die öffentliche Hand an den Pflegekosten ist eine ärztliche Verordnung gemäss KLV (Krankenpflege-Leistungsverordnung).
Nicht-pflegerische Leistungen wie z.B. Einkaufen, Kochen, Putzen, Waschen, Bügeln, Begleitung bei Arztbesuchen wie auch Nachtwachen oder Mahlzeitendienst müssen vollumfänglich von den Patienten selbst berappt werden.

Quelle: Eigenrecherche
Bildnachweis: Bild von Mohamed Hassan auf Pixabay
Pflegestufen und Pflegekosten
Pflegeleistungen werden in der Schweiz vom Krankenversiche-rungsgesetz (KVG) und der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) geregelt.
Pflegeleistungen werden von drei Parteien finanziert:
- der Obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP)
- den Versicherten
- die Restfinanzierung wird durch die Kantone geregelt und ist Aufgabe der Kantone und/oder der Gemeinden
Pflegestufen nach Faktor Zeit in Pflegeheimen
Bei dem Eintritt in ein Pflegeheim wird der Patient von einer Fachperson in eine der 12 Pflegebedarfsstufen, die den zeitlichen Bedarf pro Tag vorgeben, eingeteilt.
Je höher die Pflegestufe, desto höher ist der Zeitaufwand, desto höher sind die Kosten. So ist z.B. in Pflegestufe 12 der Pflegebedarf pro Tag höher als 220 Minuten.
Die Pflegestufe wird nach 6 Monaten noch einmal überprüft, dann erfolgt die Prüfung jährlich. Bei einer groben Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustandes erfolgt eine Neueinteilung in eine tiefere oder höhere Pflegestufe.
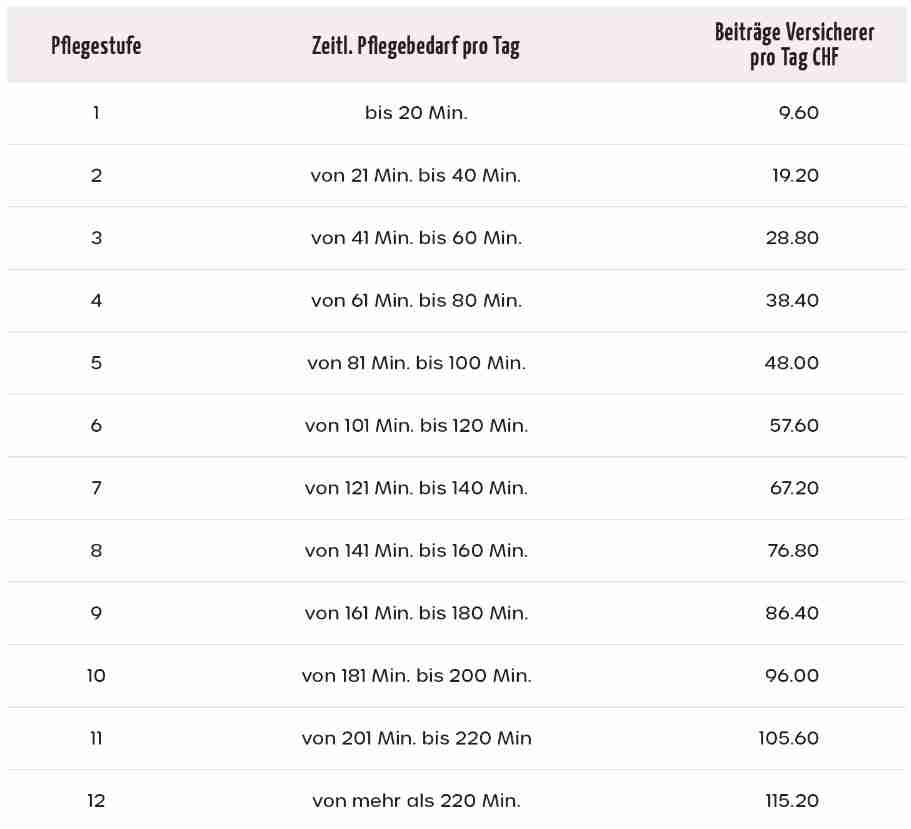
Wie hoch ist die Selbstbeteiligung für Patienten?
Die Selbstbeteiligung des Patienten richtet sich ebenfalls nach der Pflegestufe. Je höher die Pflegestufe, desto höher sind die Kosten für den Patienten und dessen Angehörige. Dabei machen die Pflegekosten nur einen geringen Teil aus.
Ein Grossteil der Kosten entsteht durch die Rundum-Betreuung, die Miete, die Verpflegung und andere flexible Dienstleistungen, die durch das Pflegeheim angeboten werden. Gemäss dem Bundesamt für Statistik kostet ein Platz in einem Pflegeheim monatlich CHF 8`700 im Durchschnitt. Davon muss der Patient etwa 2/3 der Kosten für die gesamten Leistungen des Pflegeheims übernehmen. Die Heimpflege wird nach Tagespauschale verrechnet, die häusliche Pflege im Stundentarif.
Bei niedrigeren Pflegestufen ist die Pflege und Betreuung zu Hause, wie sie von privaten Betreuungsdiensten angeboten wird, oftmals günstiger als ein Heimaufenthalt. Hinzu kommt, dass die Spitex massgeschneiderte Dienstleistungspakete zu Pflege, Betreuung und Haushalt anbietet, die sich an den individuellen Bedürfnissen der pflegebedürftigen Personen orientiert.
Unabhängig von der Arbeit der Fachkräfte muss ein maximaler Tagessatz selber getragen werden. Im Kanton Zürich ist der Höchstbetrag pro Tag 7.65 CHF (10% von 76.90 CHF pro Pflegetag). Im Kanton Aargau beträgt er 15.35 CHF pro Tag. Der Betrag wird zusätzlich zur Jahresfranchise und dem gesetzlichen Selbstbehalt erhoben. Dies gilt nur für pflegerische Leistungen, nicht für Betreuung und Haushalt. Hier müssen Patienten, abhängig von der Krankenkasse, dem Versicherungsstatus und dem Selbstbehalt, die Kosten selbst tragen.
Ab einem bestimmten Pflegebedarf ist jedoch das Wohnen zu Hause mit den diversen Unterstützungsleistungen nicht mehr die günstigere Alternative. Genauere Kalkulationen sollte man ab Pflegestufe 6 in Betracht ziehen.

Quelle: Eigenbeitrag
Bildnachweis: Bild von RosZie auf Pixabay
Haushaltsnahe Dienstleistungen für Senioren-Haushalte
Als Alternative zum Aufenthalt im Alten- oder Pflegeheim bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Senioren-Betreuung im eigenen Zuhause an.
Grundsätzlich stehen dafür folgende Varianten offen:
- Betreuung im Rahmen einer 24h-Betreuung
- Tagesbetreuung (stundenweise)
- Betreuung durch eine Hausangestellte
Welche dieser Varianten für Sie in Betracht kommt, ist abhängig von Ihren Bedürfnissen und Ihren Wünschen.
Stundenweise Betreuung
Die stundenweise Senioren-Betreuung ist die Alternative zur 24hBetreuung, wenn diese (noch) nicht erforderlich ist oder aus anderen Gründen nicht in Betracht kommt. Sie zeichnet sich aus durch folgende
Merkmale:
- Die Betreuungskraft übernimmt im Seniorenhaushalt stundenweise die Rolle einer pflegeunterstützenden Haushaltshilfe.
- Sie übernimmt Aufgaben der Grundpflege und Hauswirtschaft, Aufgaben zur Gewährleistung der Mobilität und Aufgaben im Rahmen der Alltagsbegleitung, im Vergleich zur 24h-Betreuung in anderem Umfang und mit anderen Schwerpunkten.
- Sie lebt nicht im Seniorenhaushalt und ist nicht dort angestellt.
In der praktischen Langzeit-Betreuung haben sich folgende Formen als zweckmäßig erwiesen:
- werktäglich 2-4 Stunden
(entsprechend 10 – 20 Wochenstunden) - 3 Stunden an 2-4 Wochentagen)
(entsprechend 6 – 12 Wochenstunden)
24h Betreuung
Die 24h-Betreuung hat sich in den letzten Jahren neben der Pflege durch Familienangehörige zur zweiten Säule der (ambulanten) Seniorenbetreuung entwickelt. Wenn von 24h-Betreuung die Rede ist, dann ist damit gemeint:
- Eine Betreuungskraft übernimmt im Seniorenhaushalt die Rolle einer pflegeunterstützenden Haushaltshilfe.
- Sie lebt im Seniorenhaushalt zusammen mit der zu betreuenden Person und übernimmt für diese Aufgaben der Grundpflege und Hauswirtschaft, Aufgaben zur Gewährleistung der Mobilität und Aufgaben im Rahmen der Alltagsbegleitung.
- Sie erbringt für den Seniorenhaushalt eine Dienstleistung im beschriebenen Umfang (aus rechtlichen Gründen keine Aufgaben der medizinischen Behandlungs- und Krankenpflege) und ist nicht im Seniorenhaushalt angestellt (Unterschied zur Hausangestellten).
Der Dienstleistungsumfang und Dienstplan ist abhängig von den Wünschen des Seniorenhaushalts und Ergebnis der Bedarfsanalyse. Dabei kann grundsätzlich unterschieden werden:
- Langzeit-Betreuung (auf unbefristete Zeit angelegt)
- Kurzzeit-Betreuung (befristet angelegt, z.B. als Urlaubsvertretung einer pflegenden Familienangehörigen)
Hausangestellte
Grundsätzlich hat man als Seniorenhaus-halt auch die Möglichkeit, seine Betreu-ungskraft in Voll- oder Teilzeit anzustellen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
- Der Seniorenhaushalt wird zum Arbeitgeber mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen (Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag, Bindung an die sonstigen arbeitsrecht-lichen Bestimmungen).
- Der Seniorenhaushalt hat das Weisungs-recht gegenüber der Betreuungskraft (Unterschied zum Dienstleistungs-vertrag bei einer 24h-Betreuung).
- Eine zeitlich lückenlose Betreuung ist wegen des Urlaubsanspruchs der Betreuungskraft und im Krankheitsfall nicht sichergestellt.
- Laufende Kosten in Zeiten ohne Betreuung (Urlaub und Krankheit der Betreuungskraft)
- Geringe Flexibilität im Fall der Unzufriedenheit mit der Betreuungskraft (Kündigungsfristen)
- Bürokratischer Aufwand durch Gewährleistung einer funktionierenden und gesetzeskonformen Lohnbuchhaltung und Lohnabrechnung

Quelle: Beitrag von pro infirmis (-> Link)
Bildnachweis: Bild von Frantisek Krejci auf Pixabay
Vergütung von Kosten der Pflege, Betreuung und Hilfe zu Hause durch die Ergänzungsleistungen
Ergänzungsleistungen sollen Menschen finanziell unterstützen, die wegen Lücken im übrigen Versicherungssystem ihre existentiellen Bedürfnisse nicht decken können.
Der Beitrag zeigt auf, welche Leistungen der Pflege, Betreuung und Hilfe zu Hause unter welchen Voraussetzungen von den Ergänzungsleistungen finanziert werden können.
Wer hat Anspruch auf Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten durch die EL?
Wer zwar die allgemeinen Voraussetzungen für den Bezug einer Ergänzungsleistung (Bezug einer Rente, einer Hilflosenentschädigung oder eines Taggeldes während mindestens 6 Monaten; Wohnsitz in der Schweiz; Mindestaufenthalt von 10 Jahren bei gewissen Staatsangehörigen) erfüllt, jedoch wegen eines Einnahmenüberschusses (anrechenbare Einnahmen sind höher als anrechenbare Ausgaben) keine jährliche Ergänzungsleistung bezieht, hat dann Anspruch auf Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten, wenn und soweit sie den Einnahmenüberschuss übersteigen.- Vergütung nur für Kosten, die anderweitig nicht gedeckt sind
Die Ergänzungsleistungen vergüten nur Krankheits- und Behinderungskosten, soweit diese nicht von einer anderen Versicherung (Krankenversicherung, Unfallversicherung, IV) übernommen werden müssen. Deshalb müssen die Rechnungen von Spitex-Organisationen und anerkannten Pflegefachpersonen immer zuerst an die Krankenversicherung (resp. bei unfallbedingter Pflege an die Unfallversicherung und bei Geburtsgebrechen an die IV) eingereicht werden. Erst wenn deren Abrechnung vorliegt, kann für den ungedeckten Restbetrag eine Vergütung über die Ergänzungsleistungen verlangt werden.Ob eine Hilflosenentschädigung oder ein Assistenzbeitrag bei zu Hause wohnenden Personen angerechnet oder ausser Acht gelassen wird, ist kantonal unterschiedlich geregelt. Einige Kantone rechnen die Hilflosenentschädigung und den Assistenzbeitrag an, andere verzichten darauf. Wenn eine Person allerdings im Zusammenhang mit hohen Kosten von Pflege und Betreuung eine Kostenvergütung von mehr als 25’000 Franken pro Jahr beansprucht, dann müssen die Hilflosenentschädigung und der Assistenzbeitrag in jedem Fall angerechnet werden, d.h. es werden nur die Kosten vergütet, die nicht bereits über die Hilflosenentschädigung gedeckt sind.
- Maximale jährliche Vergütung
Es gelten überall in der Schweiz dieselben Ansätze. Pro Jahr können höchstens die folgenden Beträge für Krankheits- und Behinderungskosten vergütet werden:- 25’000 Franken für Alleinstehende, verwitwete Personen sowie Ehegatten von in Heimen oder Spitälern lebenden Personen
- 50’000 Franken für Ehepaare
- 10’000 Franken für Vollwaisen
- 6’000 Franken für in Heimen und Spitälern lebende Personen
Diese Vergütungsgrenzen erhöhen sich bei Personen, die eine Hilflosenentschädigung der IV und der Unfallversicherung für mittlere und schwere Hilflosigkeit beziehen; und zwar dann, wenn die Kosten der Pflege und Betreuung, die durch die Hilflosenentschädigung nicht gedeckt sind, den Betrag von 25’000 Franken im Jahr überschreiten.Es gelten dann folgende maximale jährliche Vergütungsbeträge:
- 90’000 Franken für Alleinstehende mit einer schweren Hilflosigkeit
- 60’000 Franken für Alleinstehende mit einer mittelschweren Hilflosigkeit
- 115’000 Franken bei einem Ehepaar, wenn ein Ehegatte in schwerem Grad hilflos ist
- 180’000 Franken bei einem Ehepaar, wenn beide Ehegatten in schwerem Grad hilflos sind
- 85’000 Franken bei einem Ehepaar, wenn ein Ehegatte in mittlerem Grad hilflos ist
- 120’000 Franken bei einem Ehepaar, wenn beide Ehegatten in mittlerem Grad hilflos sind
- 150’000 Franken, wenn ein Ehegatte in schwerem, der andere in mittlerem Grad hilflos ist.
Diese erhöhten Ansätze gelten auch für Personen, die eine Hilflosenentschädigung der AHV beziehen, falls sie zuvor eine solche der IV bezogen haben
Diese erhöhten Ansätze gelten auch für Personen, die eine Hilflosenentschädigung der AHV beziehen, falls sie zuvor eine solche der IV bezogen haben.
Welche Kosten müssen von den EL vergütet werden?
Grundsätzlich ist es Sache der Kantone zu bestimmen, welche „Krankheits- und Behinderungskosten“ unter welchen Bedingungen von den Ergänzungsleistungen vergütet werden müssen. Die Kantone verfügen diesbezüglich über einen grossen Gestaltungsspielraum. Um einen gewissen gesamtschweizerischen Minimalstandard sicherzustellen hat der Bundesgesetzgeber aber immerhin festgelegt, welche Kategorien von Krankheits- und Behinderungskosten von den Kantonen im Rahmen der Ergänzungsleistungen zu vergüten sind.Es sind dies die Kosten für
- die zahnärztliche Behandlung
- die Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause
- die Hilfe, Pflege und Betreuung in Tagesstrukturen
- ärztlich angeordnete Bade- und Erholungskuren
- eine medizinisch notwendige Diät
- die Transporte zur nächstgelegenen Behandlungsstelle
- gewisse Hilfsmittel und
- die Kostenbeteiligung (Franchise, Selbstbehalt von 10%) in der Krankenversicherung

Quelle: Curaviva (→ Link).
Bildnachweis: Photo von Vlad Sargou auf Unsplash
Mit zunehmendem Alter stellen sich Menschen mit Unterstützungsbedarf und ihren Angehörigen Fragen zum Eintritt und Leben in einer Pflegeinstitution.
Im Alter ins Pflegeheim ziehen? Das wünschen sich die wenigsten Senioren und vielen mutet der Umzug in ein Heim wie eine „Reise ohne Wiederkehr“ an. Doch ein Umzug in ein gutes Pflegeheim kann viele Vorteile für Betroffene und Angehörige mit sich bringen: Die älteren Menschen verbringen zusammen mit Gleichaltrigen ihren Lebensabend, werden rundum versorgt und können an vielen Veranstaltungen teilnehmen.
Welche Wohn- und Betreuungsformen gibt es überhaupt?
Die heutigen Wohnformen für Menschen im Alter sind vielfältig und dem Grad der Begleitungs-, Betreuungs- und Pflegebedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner angepasst.
- Zu Hause alt werden. Dies entspricht dem Wunsch der meisten älter werdenden Menschen. Bei Bedarf können externer Serviceleistungen beigezogen werden. Die Pflege erfolgt durch Angehörige und/oder mithilfe ambulanter Unterstützung (Spitex).
- Alterswohnung / Alterssiedlung. Wohnungen, die spezifisch für ältere Menschen gebaut wurden. Im Idealfall nicht nur im Innern hindernisfrei gestaltet, sondern in einem altersgerechten Umfeld und gut ans Quartier und öffentliche Dienstleistungen angebunden.
- Wohnen mit Dienstleistungen / Betreutes Wohnen. Dieses Angebot kombiniert die Alterswohnung mit der Möglichkeit, je nach Bedürfnis professionelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen – Verpflegung, Haushalt, soziale Betreuung, Pflege, Kultur, Freizeit.
- Alterswohngemeinschaft. Selbst organisierte und langfristig angelegte Wohnarrangements in Form einer Alters-WG, in der alle Bewohnerinnen und Bewohner einen eigenen Raum haben. Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Gästezimmer und je nachdem auch Badezimmer werden geteilt.
- Altershausgemeinschaft. Zusammen allein wohnen: In einer selbst organisierten Altershausgemeinschaft verfügen alle Parteien über eine eigene, abschliessbare Wohnung. Je nachdem gibt es auch gemeinschaftliche Innen- und Aussenräume.
- Mehrgenerationenhaus. Eine Wohnform, in der sich verschiedene Generationen (ältere Menschen, jüngere Familien, alleinstehende Elternteile) gegenseitig ergänzen und unterstützen. Variante: Alte Menschen, die über viel Wohnraum verfügen, stellen gegen Mithilfe in Haushalt, Garten, Betreuung etc. Zimmer bzw. Wohnungen zur Verfügung.
- Altersheim. Für ältere Menschen, die nicht selbstständig leben wollen oder können, aber nicht pflegebedürftig sind. Eigenes Zimmer mit Nasszelle, aber keine eigene Küche. Dienstleistungen wie Verpflegung, Wäsche, Putzen, Beratung, Nutzung gemeinsamer Räume und Veranstaltungsangebote sind inbegriffen.
- Altersresidenz. Altersheim in gehobenem Standard mit hotel-ähnlichem Wohnangebot. Bewohner verfügen über eigene Wohnung mit Bad und Küche, leben aber gemeinsam in einer Institution mit breitem Angebot an professionellen Dienstleistungen: Schwimmbad, Restaurant, Fitnessraum, kulturelle Veranstaltungen usw. Oft auch mit Pflegeabteilung.
- Pflegeheim. Für ältere Menschen, die auf umfassende Pflege und Betreuung angewiesen sind. Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft des Pflegepersonals. Je nachdem Ein- oder Zweibettzimmer mit Nasszelle. Professionelle Dienstleistungen, die alle Lebensbereiche abdecken, gehören standardmässig dazu.
- Pflegewohngruppe. Diese haben eine ähnliche Struktur wie moderne Pflegeheime und werden oft dezentral geführt. Pflegewohngruppen sind aber auch innerhalb eines Pflegeheims eine mögliche alternative Wohnform. Die Betreuung erfolgt durch qualifiziertes Pflegepersonal.
- Tages- und Nachtstätten. Tagesbetreuungsangebote für ältere Menschen werden immer wichtiger. Die Tagesstruktur und pflegerische Betreuung wird z. B. vom angegliederten Alters- und Pflegeheim gewährleistet. Heute gibt es temporäre Betreuungsangebote etwa nach einem Spitalaufenthalt oder einer gesundheitlichen Krise, um danach wieder nach Hause zurückzukehren.
Manche Institutionen kombinieren verschiedene Wohn- und Betreuungsformen miteinander. Wie die Angebote aussehen, kann direkt bei den Institutionen erfragt werden. Einen guten Überblick bietet die Website heiminfo.ch. Hier können die Institutionen spezifisch nach den gewünschten Wohnformen durchsucht werden – auch in Kombination.
Über uns
Pflegeinfo.ch bietet eine einzigartige Pfattform zur Orientierung und zum Erhalt von Informationen für Menschen, die entweder selbst Unterstützung im Alltag benötigen oder die andere Menschen bei deren Hilfsbedürftigkeit unterstützen.
Wir sind weltanschaulich neutral, wirtschaftlich unabhängig und verfolgen mit unserem Angebot keine ökonomischen Ziele.



